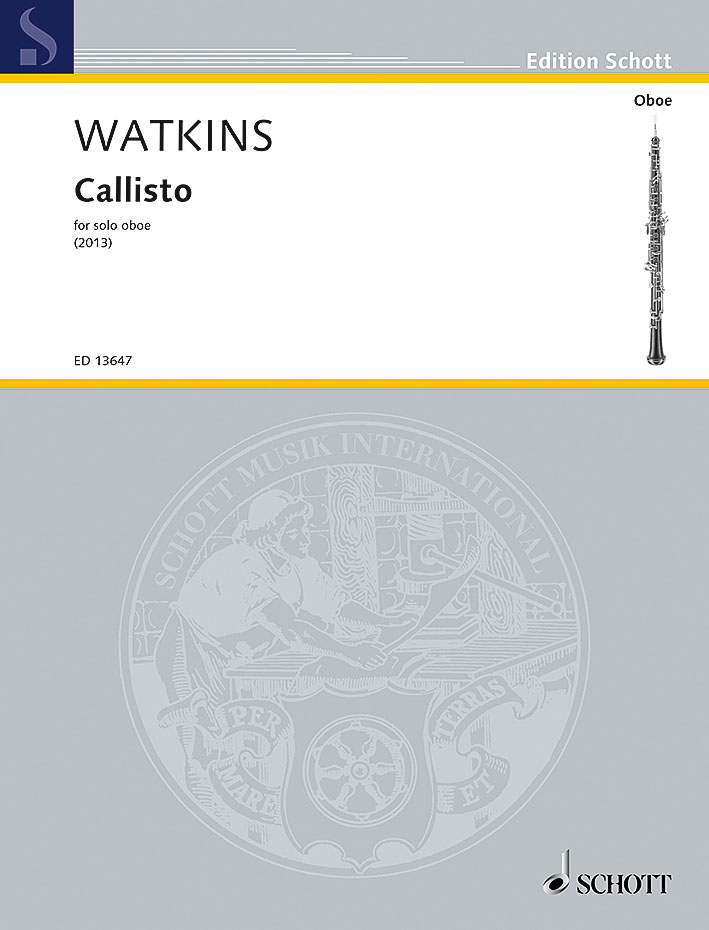Watkins, Huw
Callisto
for solo oboe
Sterngucker erkennen im Namen Callisto rasch entweder den zweitgrößten der vier Galileischen Monde des Planeten Jupiter oder assoziieren ein ganzes Sonnensystem. Beide sind nach der Nymphe Kallisto benannt, deren Namen mit „die Schönste“ übersetzt werden kann. Als Tochter des Königs Lykaon aus Arkadien war sie in der griechischen Mythologie eine Gefährtin der Jagdgöttin Diana. Sie wurde gegen ihren Willen eine Geliebte des Zeus: „Allerdings rang sie dagegen, soweit ein Weib es vermochte. Doch freilich, wen könnte ein Mädchen bezwingen? Wer über Jupiter siegen?“ Callisto wird schwanger und versucht, das zu verbergen. Während eines Bades stellen die anderen Nymphen sie bloß und verstoßen sie daraufhin. Jupiters Gemahlin Hera, die sich wenig erfreut zeigt, verwandelt sie in eine Bärin. Seitdem funkelt sie als Sternbild vom Himmel herunter. Diese und andere Verwandlungen finden sich in den berühmten Metamorphosen des Ovid, womit wir schließlich im Kern des Geschehens sind.
Der 1976 in Wales geborene Tonkünstler Huw Watkins schrieb ein etwa zweiminütiges Stück mit diesem Titel für Oboe solo. Eine gewisse Affinität zu den 1952 erschienenen Sechs Metamorphosen nach Ovid von Benjamin Britten ist sicherlich gewollt. Außerdem war der Aulos, der antike Vorgänger der Oboe, das wichtigste Blasinstrument der Griechen.
Inzwischen kann Watkins, herausragender Pianist und Professor für Komposition an der Royal Academy of Music, auf ein beachtliches Schaffen blicken: zahlreiche Konzerte für Violine, Violoncello, Flöte, Klavier, ein Doppelkonzert sowie eine Reihe von kammermusikalischen Werken, Vokalstücken und zwei Kammeropern. Vorliegendes Stück komponierte Watkins 2013. Die Uraufführung fand am 19. September desselben Jahres in der Holy Trinity Church während des Leicester International Music Festivals durch den Oboisten Nicholas Daniel statt. Nun brachte Schott diese „Metamorphose“ ohne Vorwort oder Erläuterung heraus. Infos darüber wie auch die beeindruckende Vita des Tonkünstlers finden sich auf der Homepage des Verlags.
Ähnlich wie bei Britten findet während des Verlaufs eine programmatische wie musikalische Verwandlung statt. Zunächst wild und ungezähmt in unterschiedlichen geraden und ungeraden Sechzehntel- und Achtel-Takten mit hektischen 160 Vierteln pro Minute, dynamisch extrem polarisierend, beruhigt sich der überaus virtuose Teil ab Takt 44 in einem „Allargando“ fast um die Hälfte des Anfangstempos. Dafür extreme, viermalige Sprünge von a’ zu g”’, um dann im dreifachen Fortissimo mit der Vortragsbezeichnung „feroce“ (unbändig) zum h zu stürzen. Ein Absturz, der sich im Verlauf, nun eher figurativ, wiederholt und in Takt 65 mit dem b die unterste Schwelle erreicht. Mit einer achtmaligen Sechzehntel- und Quintolen-Kette mit verwehendem Diminuendo bis zum es”’ scheint ab Takt 78 Callisto im Tranquillo-Tempo kontemplativ im dreifachen Pianissimo zu leuchten.
Werner Bodendorff