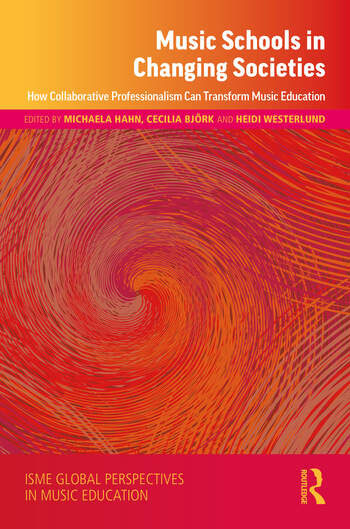Hahn, Michaela / Cecilia Björk / Heidi Westerlund (Hg.)
Music Schools in Changing Societies
How Collaborative Professionalism Can Transform Music Education
Kollaboration: Ein neuer Leitbegriff für die Musikpädagogik?
Rezension zu:
Hahn, M., Björk, C., & Westerlund, H. (Hg.) (2024). Music Schools in Changing Societies. How Collaborative Professionalism Can Transform Music Education. Routledge. https://doi.org/10.4324/9781003365808
Rezensent: Wolfgang Lessing
Rezension veröffentlicht am: 12.08.2025
Anders als im Deutschen, wo der Begriff der Kollaboration noch bis vor nicht allzu langer Zeit ausschließlich negativ besetzt war – als Verräter, die mit dem „Feind“ paktierten, wurden Kollaborateure nicht nur in der Nazizeit mit dem Tode bestraft –, wird im Englischen jede Form der Zusammenarbeit als „collaboration“ bezeichnet. Die sprachliche Wertneutralität macht es dort allerdings notwendig, den Begriff, soll er mehr und anderes meinen als etwa eine bloße Arbeitsteilung unter Spezialist:innen, weiter auszudifferenzieren. Um als Leitbegriff eines „groundbreaking turn“ (S. 13) beispielsweise in der Musikpädagogik tragfähig zu sein, muss er sich von anderen Formen der Zusammenarbeit deutlich unterscheiden lassen. Die Notwendigkeit einer Differenzierung hat aber auch in Deutschland ihre Spuren hinterlassen: Die hierzulande in den vergangenen 15 Jahren zu beobachtende Neusemantisierung des Kollaborationsbegriffs in Soziologie und Erziehungswissenschaft (siehe Bornemann, 2011; Terkessides, 2015; Betz & Bollig, 2023) ist weniger der unreflektierten Übernahme eines anglo-amerikanischen Konstrukts geschuldet, sondern ergab sich aus der Notwendigkeit, sich von dem bis dato vorherrschenden Begriff der Kooperation abzugrenzen. Während mit dem letztgenannten Begriff eine Zusammenarbeit bezeichnet werden kann, bei dem Individuen oder Institutionen in Bezug auf bestimmte vordefinierte Aufgaben vorübergehend miteinander paktieren, ohne sich dabei aber selbst verändern zu müssen, bedeutet der weitaus anspruchsvollere Begriff der Kollaboration, wie Mark Terkessides es in seinem gleichnamigen Buch ausgeführt hat, einen langfristigen und auf Nachhaltigkeit ausgerichteten Austausch zwischen lernenden Institutionen und eigenverantwortlichen Individuen (Terkessides, 2015).
1. „Professional collaboration“ vs. „Collaborative professionalism“
Einen vergleichbar anspruchsvollen Kollaborationsbegriff als Orientierungspunkt für die künftige Arbeit von Musikschulen zu begründen und zu etablieren, ist das Ziel der vorliegenden Publikation. Den Herausgeberinnen geht es dabei nicht in erster Linie um eine theoretische Auseinandersetzung mit dem Begriff – die Literaturbasis, die dazu nötig wäre, ist im ganzen Buch eher schmal –, als vielmehr um die Darstellung und Präsentation vielfältiger Kollaborationspraktiken, die sich in den letzten Jahren an Musikschulen in Europa entwickelt haben. Diese Praktiken in ihrer Vielfalt deutlich zu machen, ist ein großes Verdienst der Publikation. Leser:innen dürften am Ende ihrer Lektüre überrascht sein, auf welch unterschiedlichen Ebenen sich Kollaboration denken und praktizieren lässt. Die Beiträge behandeln, um nur eine kleine Auswahl zu nennen, die Kollaboration von Musikschul-Schüler:innen (in Finnland), von Musikschulen, Konservatorien und Musikgymnasien (in Österreich), von Musikschulen und den sie umgebenden innerstädtischen Räumen (in Frankreich), von der internationalen Partnerschaft einzelner Musikschulen (am Beispiel Deutschland und Griechenland) oder von Musikschullehrkräften und Forschenden (wiederum in Finnland). Was als möglicherweise wahllos wirkende Anhäufung unterschiedlicher Praxisbeispiele erscheinen mag, erweist sich bei näherem Hinsehen als durchaus planvoll konzipiert, gelingt es den Herausgeberinnen doch, mit jedem Beitrag eine neue Facette kollaborativen Zusammenwirkens zu präsentieren; nicht eine einzige erscheint auch nur ein zweites Mal!
Um dem Anspruch, Kollaboration als eine „essential dimension of instrumental and vocal teaching“ (S. 25) auszuweisen und als „significant strategy for addressing the many criteria what counts as good work and excellence in professional practice“ (S. 19, 24) zu begründen, ist es notwendig, den Kollaborationsbegriff so zu schärfen, dass mit ihm nicht lediglich eine professionelle Zusammenarbeit („professional collaboration“), sondern – gerade umgekehrt – eine auf Zusammenarbeit gründende Professionalität gemeint ist, die die Herausgeberinnen im Anschluss an Hargreaves und O’Connor (2018) als „collaborative professionalism“ bezeichnen. Diese Unterscheidung bezeichnet die auch in den Titel eingeflossene Leitdifferenz der Publikation und wird in zahlreichen Kapiteln aufgegriffen. Die Vertauschung von Substantiv und Adjektiv macht die Tragweite des Ansatzes deutlich: Es geht also nicht um eine zeitweise und projektgebundene Zusammenarbeit von professionell ausgebildeten Musikpädagog:innen bzw. von Institutionen. Vielmehr wird die Fähigkeit zur Kollaboration selbst zu einem wichtigen – wenn nicht gar entscheidenden – Kennzeichen von Professionalität. Um dies nachvollziehbar zu machen, ist es notwendig, Kollaboration als eine Kategorie auszuweisen, die in den Kern (musik)pädagogischer Arbeit hineinreicht. Dies wird möglich, sobald man sie mit Leitbegriffen wie „Inklusion“, „Teilhabe“ oder „Heterogenität“ in Verbindung bringt. In diesem Sinne sehen die Herausgeberinnen als eine zentrale Aufgabe künftiger Musikschularbeit die Frage, inwieweit „music schools […] may, and are able to, respond to new policies suggesting a more active stance towards inclusion and integration of immigrants“. (S. 15–16) Kollaboration wird damit zu einem Schlüsselbegriff für einen produktiven Umgang mit unterschiedlichsten Formen von Diversität (z. B. Blanchard, 2019; Löbbert, 2024) und anschlussfähig an eine Reihe anderer aktuell diskutierter Begriffe wie etwa „Artistic Citizenship“ (Lessing, 2022).
Thematisch sind die Beiträge in drei Abteilungen gegliedert: Werden in einem ersten Teil kollaborative Praxen des Lehrens und Lernens vorgestellt, so geht es im zweiten Teil um die Zusammenarbeit von Institutionen (gleichen oder unterschiedlichen Typs); abschließend stehen dann landesweite Projekte im Vordergrund, die Kollaboration entweder direkt realisieren oder ermöglichen wollen. Da es im Rahmen einer Rezension nicht möglich ist, auf jeden Beitrag eines Sammelbandes genauer einzugehen und eine Kurzparaphrase aller Artikel ebenfalls kaum zielführend erscheint – interessierte Leser:innen finden einen Überblick über alle Beiträge in der Einleitung des Buches (S. 5–9) –, sei im Folgenden aus jedem der drei Teile jeweils ein Text umfassender gewürdigt. Die Auswahl orientierte sich an der Frage, an welchem der behandelten Projekte sich die Potenziale, aber möglicherweise auch Grenzen eines „collaborative professionalism“ besonders deutlich machen lassen.
2. „Collaborative teaching and learning“
In ihrem Beitrag „Enhancing professionalism through collaboration“ berichtet Cecilia Björk von der Kollaboration zwischen ihr als Forscherin und fünf Lehrkräften an vier finnischen Musikschulen (S. 57–72). Dieses Projekt war Teil einer übergreifenden Studie, in der es darum ging zu verstehen, wie Musikschullehrkräfte in ihrer Unterrichtspraxis zwischen den Vorgaben des nationalen finnischen Musikschulcurriculums und den Motivationslagen bzw. den langfristigen Interessen ihrer Schüler:innen balancieren. Von besonderem Interesse für die Kollaborations-Thematik ist die Tatsache, dass Kollaboration in diesem Projekt auf zwei unterschiedlichen, letztlich aber einander bedingenden Ebenen praktiziert wurde. Ging es zum einen um die Initiierung eines kontinuierlichen gegenseitigen Austauschs der Lehrkräfte zu bestimmten Fragen, die ihren Unterrichtsalltag prägen (z. B. um die Frage, wie Lehrkräfte Schüler:innen unterstützen können, deren Instrumentenwahl keinen Gender-Stereotypen folgt, oder um die Suche nach innovativen Methoden für die Einbindung musiktheoretischer Inhalte in den Unterricht), so war zum anderen diese Zusammenarbeit auf eine gleichzeitige Kollaboration von Lehrkräften und Forscherin angewiesen. Die Aufgabe von Cecilia Björk bestand darin, bei den Lehrkräften eine gemeinsam forschende Grundhaltung (im Sinne einer „citizen science“, z. B. Bonney, 2009, Finke, 2014) zu initiieren und diese Haltung durch das Einbringen ihrer Expertise als wissenschaftlich arbeitende Musikpädagogin zu unterstützen. In diesem doppelten Kollaborations-Setting konnten einerseits Faktoren identifiziert werden, die einer Kollaboration hinderlich sind (z. B. Konkurrenzverhalten unter den Lehrenden oder Vorurteile der Lehrkräfte gegenüber Wissenschaftler:innen und umgekehrt), als auch Wege aufgezeigt werden, wie sich diese Hindernisse aus dem Weg räumen lassen. Am Ende zeigte sich, dass von einem derart behutsam initiierten gemeinsamen Forschen zu Themen, die von den Teilnehmenden als wichtig und zentral empfunden wurden, beide Seiten erheblich profitieren konnten: Während die Forscherin authentisches Datenmaterial in Bezug auf die alltäglichen Problemstellungen von Musikschularbeit zu generieren vermochte, zeigen die Interviews mit den Lehrkräften, dass aus der gemeinsamen Arbeit ein Wir-Gefühl erwuchs, dessen Fehlen im institutionellen Alltag zugleich beklagt wurde.
3. „Cross-sectoral collaboration“
Ein interessantes Beispiel für die im zweiten Teil des Buches thematisierten institutionellen Kollaborationen liefert der Beitrag der kroatischen Musikpädagogin Ana Čorić. Hier wird am Beispiel der von der Jeunesses Musicales initiierten Jugendcamps „Ethno“ demonstriert, wie von Events, in deren Zentrum die Beschäftigung mit Folk und World Music steht, langfristige Wirkungen auf die Arbeit etablierter Institutionen ausgehen können. Das Beispiel zeigt, dass der häufig beschworene – und nicht selten polemisch zugespitzte – Gegensatz zwischen punktuellen Events und langfristiger Arbeit in Institutionen mitunter zu kurz greift: Obgleich die „Ethno“-Camps an unterschiedlichen Orten Europas stattfinden und insofern für die jeweiligen Kommunen ein nicht unbedingt nachhaltiges kulturelles Ereignis unter vielen anderen darstellen, sind sie doch so konzipiert, dass an den Aktivitäten der Ethno-Musiker:innen auch die regionalen Schulen und Musikschulen partizipieren können, wodurch sich im Nachgang der Treffen neue Lernkulturen (z. B. hinsichtlich des Umgangs mit Notation und Improvisation) bei den Lehrkräften der Institutionen etablieren. Hier zeigt sich, dass auch singuläre Ereignisse, sofern sie an die Bedürfnisse von Lehrkräften und Schüler:innen anknüpfen, längerfristig Funken schlagen können; die Nachhaltigkeit einer die Institutionen verändernden Kollaborationspraxis ist nicht unbedingt auf eine kontinuierliche Bindung angewiesen. Sie kann, wie es etwa beim Festival „Ethno France“ versucht wurde (S. 94–96), auch über die Expertisierung einzelner Musiker:innen erfolgen, die die neu erlernten Impulse dann in ihrer jeweiligen Institution weiterwirken lassen, woraus dann die Chance einer erhöhten Diversität der musikschulischen Angebote erwächst.
4. „Policy-driven collaboration“
An dem den dritten Teil und damit die gesamte Publikation beschließenden Beitrag von Peter Renshaw zeigt sich eindrücklich, dass die Entwicklung kollaborativer Strukturen innerhalb von Institutionen auf das Engste an eine Neujustierung des Verhältnisses von künstlerischer Expertise und sozialer Verantwortung gebunden ist. Im Anschluss und in Übereinstimmung mit dem Autor:innenteam des Beitrags „Musicians as Makers of Society“ (Gaunt, Duffy, Čorić, Gonzáles Delgado, Messas, Pryimenko & Sveidahl, 2021) geht Renshaw davon aus, dass die Künste einen Beitrag zu weitreichenden sozialen Herausforderungen leisten müssen. „Musical practice“, so zitiert er die Autor:innen, „may indeed be able to resonate with and connect people, make meaning and contribute to shaping social relations and societal development” (S. 194). Die unerlässliche Vorbedingung für einen institutionellen Wandel besteht für Renshaw in der Aufgabe, die Kluft zwischen einer bloßen „Rhetorik der Kollaboration“ und der Realität zu erkennen (S. 192–194). Wenn Kollaboration sich nicht in top-down gesteuerten Partnerschaften erschöpfen soll, die die Alltagspraxis der Akteur:innen weitgehend unverändert lässt, so müssen die Institutionen Räume schaffen und gewährleisten, in denen vormalige „Silos“ aufgebrochen werden, in denen Abteilungen mit unterschiedlichen Zielsetzungen plötzlich zusammenfinden müssen und in denen zwischen unterschiedlichen Interessensgruppen geteilte Visionen entstehen können. Dies alles ist nicht möglich, wenn nicht alle Beteiligten eine Stimme haben – und Renshaw macht unmissverständlich klar, dass es ihm insbesondere auf die Stimme der Jugend ankommt, in deren Namen Institutionen oftmals zu handeln vorgeben, auch wenn sie dabei lediglich bestehende Traditionen fortschreiben.
5. Ausblick
Renshaw schrieb seinen Beitrag unmittelbar nach der Covid-19-Pandemie. Angesichts dieser globalen Krise, der Klimakatastrophe und den nicht minder verstörenden Bildern, die zur Black Lives Matter-Bewegung geführt haben, schien ihm die Zeit reif zu sein für einen radikalen Perspektivenwechsel. „Individuals and institutions are having to adapt to a radically changing landscape, as they are forced to question old assumptions, realign priorities, and enter a period of reappraisal, reimaging, and reinvention“ (S. 188). Nur wenige Jahre später, im April 2025, lesen sich diese Sätze, so sehr sie vom Bewusstsein einer globalen Krise unbekannten Ausmaßes geprägt sein mögen, fast wie eine Idylle. Denn unbeschadet der Situationsdramatik, aus der heraus sie formuliert wurden, gehen sie doch gleichsam selbstverständlich davon aus, dass die genannten Krisen auf einer kommunikativ einsichtigen und damit die Menschen potenziell verbindenden Basis beruhen. Dass nur wenige Jahre später eben dieser Konsens, aus dessen Kraft Renshaw Hoffnung für weitreichende institutionelle Transformationsprozesse schöpfte, von rechtspopulistischen und faschistischen Kräften auf beiden Seiten des Atlantiks aufgekündigt wird, um an die Stelle von Kollaboration tribalistische Freund-Feind-Kategorien zu setzen, war in diesem Ausmaß nur schwer vorstellbar. Was bedeutet dieser radikale Einschnitt für den Kollaborationsgedanken, der in der hier besprochenen Publikation ja nicht nur auf Individuen und einzelne Institutionen, sondern immer wieder auch auf den gesellschaftlichen Raum als Ganzes bezogen wird? Sicher scheint, dass sich der hier vertretene Kollaborationsbegriff beispielsweise im aktuellen US-amerikanischen Kontext bis auf Weiteres nicht mehr als eine auf großem gesellschaftlichen Konsens beruhende Zielbestimmung denken lassen wird. Eine Musikpädagogik, die es sich gleichsam selbstverständlich zum Ziel setzt, durch kollaboratives Handeln und ein Sichtbarmachen von Diversität Teilhabegerechtigkeit zu fördern, wird sich – ohne dies hier heraufbeschwören zu wollen – auch hierzulande vielleicht nicht immer staatlicher Förderprogramme und gesamtgesellschaftlichen Zuspruchs erfreuen können, wodurch Kollaboration möglicherweise zu einer Angriffsfläche für rechte Populist:innen mutiert, von der sich fragen lässt, inwieweit sich ihr mit Kollaboration begegnen lässt. Aber vielleicht ist gerade die neu gewachsene Einsicht in die Zerbrechlichkeit des gesellschaftlichen Konsenses ein umso stärkeres Argument für die Entwicklung kollaborativer Strukturen innerhalb und außerhalb von Institutionen? Allen Menschen mit ihren je eigenen musikalischen Praxen eine Stimme zu geben, ist vielleicht die einzige Möglichkeit, diesen Konsens von unten her neu und nachhaltig zu etablieren.
Diese letzten Gedanken mögen abschließend mit einer leisen Kritik an dieser insgesamt so eindrucksvollen Textsammlung verbunden werden. Es hat mitunter den Anschein, dass Kollaboration von den Autor:innen als ein allzu probates und leicht verfügbares Gegengift gegen gesellschaftliche Stratifikationen aller Art gedacht wird und die Schwierigkeiten ihrer Realisierung zwar genannt, aber gleichsam im Eilschritt überwunden werden. Das mag vielleicht auch mit der Art und Weise zusammenhängen, in der die Autor:innen der einzelnen Beiträge ihre Daten erhoben haben (wobei insgesamt zu sagen ist, dass sich in kaum einem Beitrag genauere methodische und methodologische Reflexionen finden lassen). Es fragt sich – überspitzt formuliert –, ob sich aus bloßen Meinungsäußerungen von Beteiligten zu bestimmten Projekten wirklich Erfolgsgeschichten konstruieren lassen. Aus der praxeologischen Wissenssoziologie (Bohnsack, 2017) wissen wir, dass die in Interviews oder Gruppendiskussionen geäußerten Überzeugungen der Beteiligten in aller Regel nur eine explizite Oberfläche darstellen, unter der sich habituelle Orientierungen verbergen, die die Alltagspraxis der Beteiligten implizit bestimmen, ohne dass sie direkt Einfluss darauf nehmen könnten. Eben diese habituellen Orientierungen können, wie Untersuchungen zur Kooperationspraxis von Musikvereinen und Musikschulen (Borchert, Bons, Buchborn & Lessing, 2022, S. 349–368) oder zum musikschulischen Umgang mit Inklusion in Deutschland (Löbbert, 2024) zeigen, auf der impliziten Ebene doch Widerständigkeiten und Handlungshemmungen mit sich führen, auch wenn die Beteiligten auf der Common-sense-Ebene Kollaboration durchaus bejahen und einfordern. Diese Spannungen zwischen Norm und Habitus verstärkt herauszuarbeiten, gelingt in der vorliegenden Publikation nur vereinzelt und ist zweifellos eine wichtige Aufgabe künftiger Musikschulforschung.
Literatur
Betz, T., & Bollig, S. (2023) (Hg.). Bildungs- und Erziehungspartnerschaften in der frühkindlichen Bildung. Doing Collaboration als Konzept zur Erforschung eines Programms. In R. Schelle, K. Blatter, S. Michl & B. Kalicki (Hg.), Qualitätsentwicklung in der Frühen Bildung. Akteure – Organisationen – Systeme (S. 200–227). Beltz Juventa. DOI: 10.25656/01:2808
Blanchard, O. (2019): Hegemonie im Musikunterricht. Die Befremdung der eigenen Kultur als Bedingung für den verständigen Umgang mit kultureller Diversität. Waxmann. DOI: 10.25656/01:30144
Bohnsack, R. (2017). Praxeologische Wissenssoziologie. Barbara Budrich.
Bonney, R., Ballard, H., Jordan, R., McCallie, E., Phillips, T., Shirk, J., & Wilderman, C. (2009), Public Participation in Scientific Research: Defining the Field and Assessing Its Potential for Informal Science Education – A CAISE Inqury Group Report, in: birds.cornell.edu. Center for Advancement of Informal Science Education (CAISE). Online verfügbar unter: https://web.archive.org/web/20190819022300/http://www.birds.cornell.edu/citscitoolkit/publications/CAISE-PPSR-report-2009.pdf (zuletzt aufgerufen am 22.1.2025).
Bons, V., Borchert, J., Buchborn, T., & Lessing, W. (2022). Wie verorten Mitglieder von Musikvereinen ihre Arbeit in Abgrenzung zur Praxis von Musikschulen? Eine dokumentarische Studie zu Musikvereinen im ländlichen Raum. In N. Kolleck, M. Büdel & J. Nolting (Hg.), Forschung zu kultureller Bildung in ländlichen Räumen. Methoden, Theorien und erste Befunde (S. 349–368). Beltz Juventa.
Bornemann, S. (2011). Kooperation und Kollaboration. Springer VS.
Finke, P. (2014). Citizen Science: Das unterschätzte Wissen der Laien. oekom-verlag.
Gaunt, H., Duffy, C., Čorić, A., Gonzáles Delgado, I., Messas, L., Pryimenko, O., & Sveidahl, H. (2021). Musicians as “Makers in Society”: A Conceptual Foundation for Contemporary in Professional Higher Music Education. In Frontiers in Psychology, Sektion Performance Science, Vol. 12. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.713648
Hargreaves, A., & O’Connor, M.T. (2018). Collaborative Professionalism: When teaching together means learning for all. Corwin.
Lessing, W. (2023). Artistic Citizenship. Überlegungen zur Grundlegung eines musikpädagogischen Orientierungsbegriffs. üben & musizieren.research, Sonderausgabe Artistic Citizenship, 16–53. Online verfügbar unter: https://uebenundmusizieren.de/artikel/research_artistic-citizenship_lessing/
Löbbert, C. (2024). Musikschulkultur und Inklusion. Eine empirische Studie. Olms.
Terkessides, M. (2015). Kollaboration. Suhrkamp.
Wolfgang Lessing
Hochschule für Musik Freiburg im Breisgau
Mendelssohn-Bartholdy-Platz 1
79102 Freiburg
Deutschland
E-Mail: le*****@*********rg.de
Forschungsschwerpunkte: Soziale Rahmenbedingungen des instrumentalen Lernens und Musizierens, Historische und systematische Studien zu den zentralen Begriffen der Instrumental- / Gesangspädagogik, Philosophische Grundlagen des Übens und Musizierens