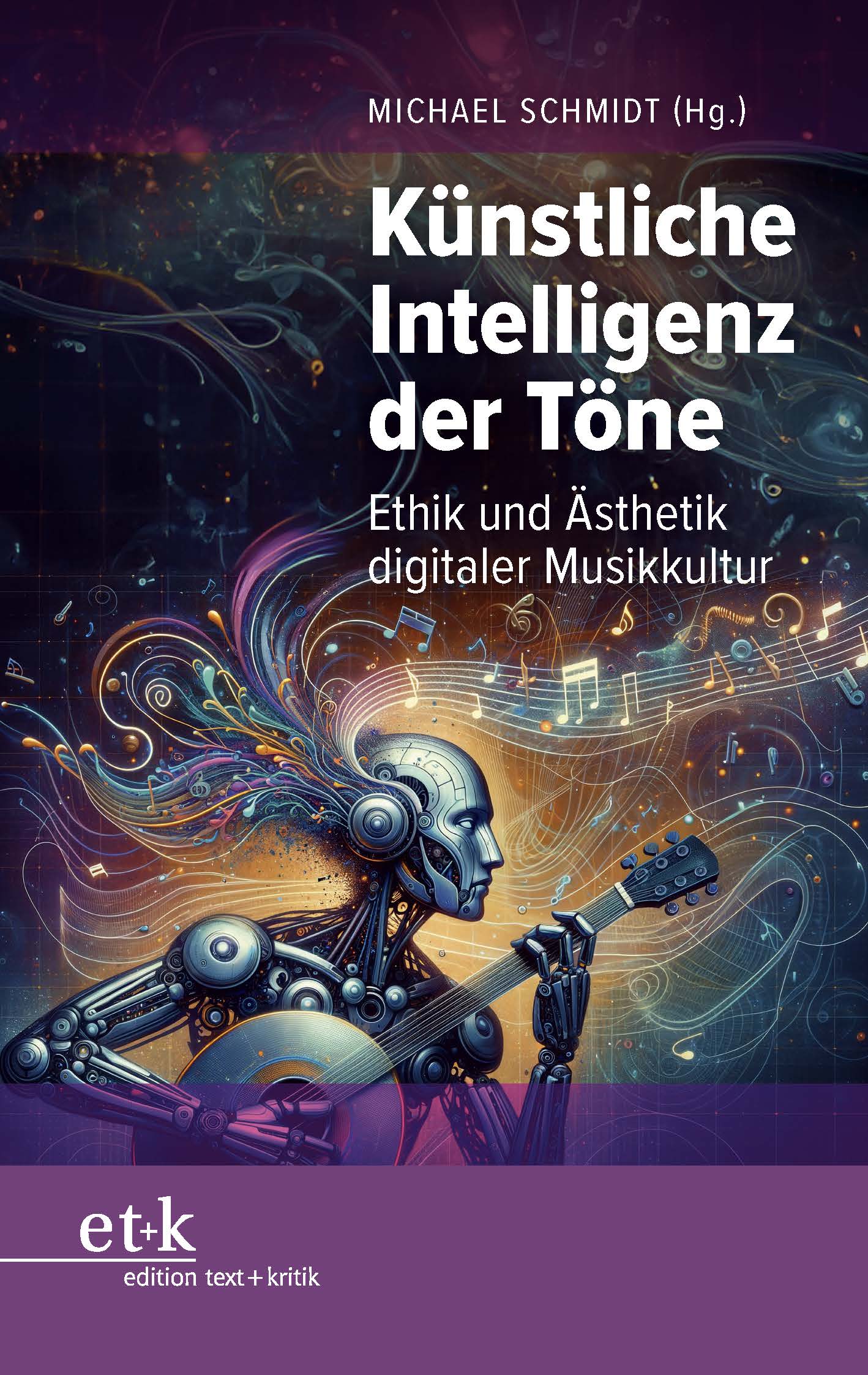Schmidt, Michael (Hg.)
Künstliche Intelligenz der Töne
Ethik und Ästhetik digitaler Musikkultur
Was Künstliche Intelligenz kann, wie sie funktioniert, welche rechtlichen, künstlerischen und ethischen Fragen sie aufwirft und wie sie unsere musikalische Zukunft mitgestaltet – das ist ein weites Feld. Der Komponist Ludger Brümmer hält aus der eigenen Praxis erst einmal fest, was viele besorgte KollegInnen und vielleicht ja auch uns als Publikum beruhigen wird: „Musik, die von KI-Systemen automatisch und ohne kuratorisches Eingreifen von Menschen erzeugt […] wird, ist gegenwärtig nur als Hintergrundmusik akzeptabel.“ Damit widerspricht er Matthias Röder von der Karajan-Stiftung, der arg vollmundig der KI schon jetzt ein „tiefes Verständnis des kulturellen Erbes“ attestiert: Genau das aber, so Brümmer, gehe der KI grundsätzlich ab: „Ihre Schwäche [liegt] im Fehlen jeglicher gesellschaftlicher und sinnlicher Sensorien.“
So kann KI erkennen, was uns gefällt und was nicht. Aber sie wird zum Beispiel nie ein Gefühl dafür entwickeln, wann es an der Zeit ist, mit alten Gewohnheiten zu brechen. Und Brümmer fragt sich und uns: „Wäre [sie] in der Lage, den Übergang von der tonalen zur atonalen Musik zu vollziehen?“ Vermutlich nicht.
Rechtswissenschaftler Thilo Klawonn verweist auf Klagen gegen Unternehmen wie Suno und Udio. Sie verkaufen KI-generierte Musik auf der Basis von hunderttausenden zuvor ausgewerteten Songs aus dem Internet. Das dürften sie ohne Einwilligung der UrheberInnen nicht, und es gibt Mittel, dem von Seiten der Politik einen Riegel vorzuschieben. Doch das künstlerische Urheberrecht steht heute auf dünnen Fundamenten: „Durch die inzwischen nur noch sehr geringe Schöpfungshöhe, die man erreichen muss, um ein Urheberrecht zu erhalten, hat es sich von seinem Ursprung als Genie-Urheberrecht längst fortentwickelt. […] Urheberrecht ist heutzutage überwiegend Wirtschaftsrecht.“ Schon möglich also, dass eine KI nichts wirklich Neues schafft. Das tun die meisten menschlichen Urheber aber auch nicht mehr.
Mit einem wesentlich existenzielleren Problem konfrontiert uns Digitalexperte Frizz Lauterbach: Sollten wir uns damit abfinden, dass wir KI-Modelle mit Daten füttern, um dann mit Ergebnissen konfrontiert zu werden, deren Grundlagen wir nicht mehr nachvollziehen können? Denn, so Lauterbach: Auch „die Schöpfer [der KI] können nicht verstehen und erklären, wie die KI ein bestimmtes Resultat generiert“. Das Problem betrifft weniger den Spezialfall Musik, sondern uns als ganze Gesellschaft. Denn KI urteilt anders als Menschen: Sie kennt nur „ja“ oder „nein“ und kann mit einem „dazwischen“ nicht umgehen. Dabei lebt eine Kultur von der Uneindeutigkeit der Welt und der Möglichkeit jedes einzelnen, diese Uneindeutigkeit für sich persönlich fortwährend neu zu interpretieren. Genau dieses Herzstück unserer Kultur ist in Gefahr, wenn wir diesen Unterschied zur Maschine ignorieren.
Raoul Mörchen