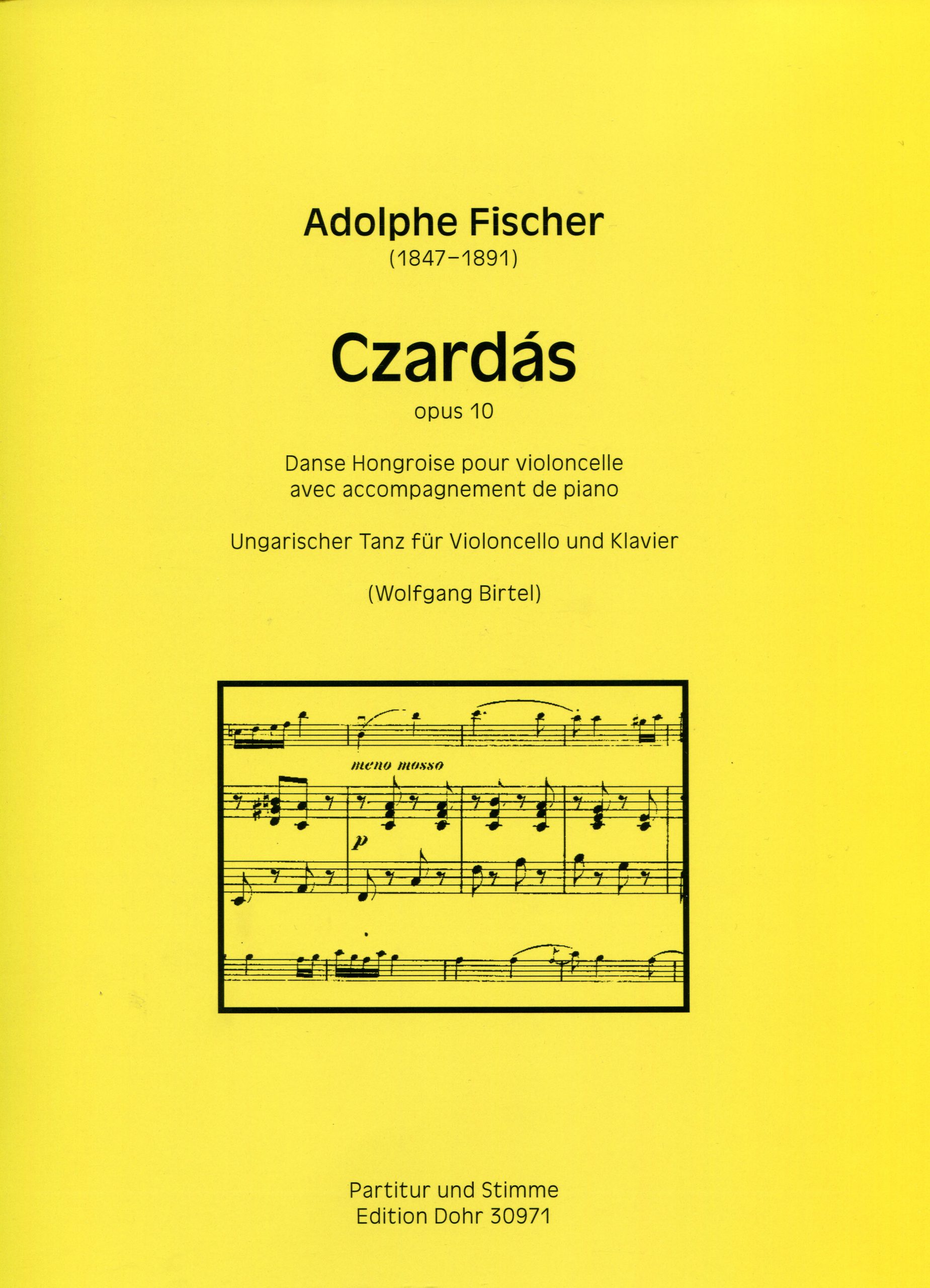Fischer, Adolphe
Czardás op. 10
Ungarischer Tanz für Violoncello und Klavier, hg. von Wolfgang Birtel, Partitur und Stimme
Alle Welt kennt Vittorio Montis Czardás, jenen Inbegriff „ungarischer“ Musik in salongerechter Aufmachung. Die 1904 für Violine und Klavier komponierte Pièce erfuhr zahlreiche Bearbeitungen, auch die cellospielende Welt ergriff von ihr Besitz. Viel weniger bekannt war und ist ein Original-Czardás für Cello: Exakt auf dieselbe Weise geformt – einer langsamen Einleitung folgt der eigentliche, rasante Czardás-Tanz – und mit ebenso viel Esprit, Pfeffer und Paprika gewürzt, steht er Montis Erfolgsstück in kaum etwas nach: der Czardás von Adolphe Fischer (1847-1891).
Bedauerlicherweise verrät die Neuedition nichts über den Cellisten-Komponisten. Auf Umwegen erfahren wir: Fischer hat am Brüsseler Konservatorium bei Adrien-Francois Servais studiert. Später lebte er in Paris, von dort aus unternahm er ausgedehnte Konzerttourneen. Er war Uraufführungssolist des Cellokonzerts von Edouard Lalo, einige Quellen nennen seinen Namen gar als Co-Autor des Konzerts. Weitere Kompositionen aus Fischers Feder sind: eine Barcarolle, eine Tarantelle sowie – des Czardás’ Heimat lässt grüßen – eine Danse à la hongroise.
Fischers Czardás wurde 1879 erstveröffentlicht, die vorliegende Ausgabe gibt Striche und Fingersätze entsprechend dem Erstdruck wieder. Das einleitende Largo ist gespickt mit genre-üblichen „Haltestellen“: Fermaten, bei denen das begleitende Klavier auf einem Akkord verharrt, bis das Soloinstrument in schönster Zymbal-Manier seine kadenzierenden (präzis ausnotierten!) Improvisationen beendet hat und Bereitschaft zum Weiterschreiten signalisiert. Die rhapsodischen Ausschweifungen verlangen einiges an Geläufigkeit, girlandenartig schraubt sich der Cellopart hier bis weit in die zwei- und bisweilen in die dreigestrichene Oktave. Nach einem plagalen Schluss beginnt der eigentliche Czardás-Teil, dessen Hauptthema Affinitäten zur Motivik des 5. Ungarischen Tanzes von Brahms aufweist. „Gelenkter“ Zufall? Zugleich nehmen wir jetzt wahr, dass die Melodie bereits im 2. Teil der Largo-Introduktion angeklungen ist und nun in beschleunigter Form wiederkehrt.
Das komplette Geschehen des Czardás spielt sich, cellistisch formuliert, auf der D- und A-Saite ab. Tiefster Ton ist das kleine D, höchster Ton das zweigestrichene a. Es bedarf gewiss einer guten Griffsicherheit in den Daumenlagen, von dieser Warte aus betrachtet sind die technischen Anforderungen indes nicht exorbitant hoch. Fortgeschrittene SchülerInnen dürften das Stück als dankbare Herausforderung empfinden – und Spaß macht’s obendrein!
Ein Wort noch zur – leider ebenfalls unkommentierten – Widmung „à Madame Bertha Krupp“: Gemeint dürfte die Ehefrau des Erfinders und Industriellen Alfred Krupp sein. Zu gern wüssten wir, was einen frankofonen Cellisten bewogen haben mag, dieser Dame einen Czardás zu widmen.
Gerhard Anders