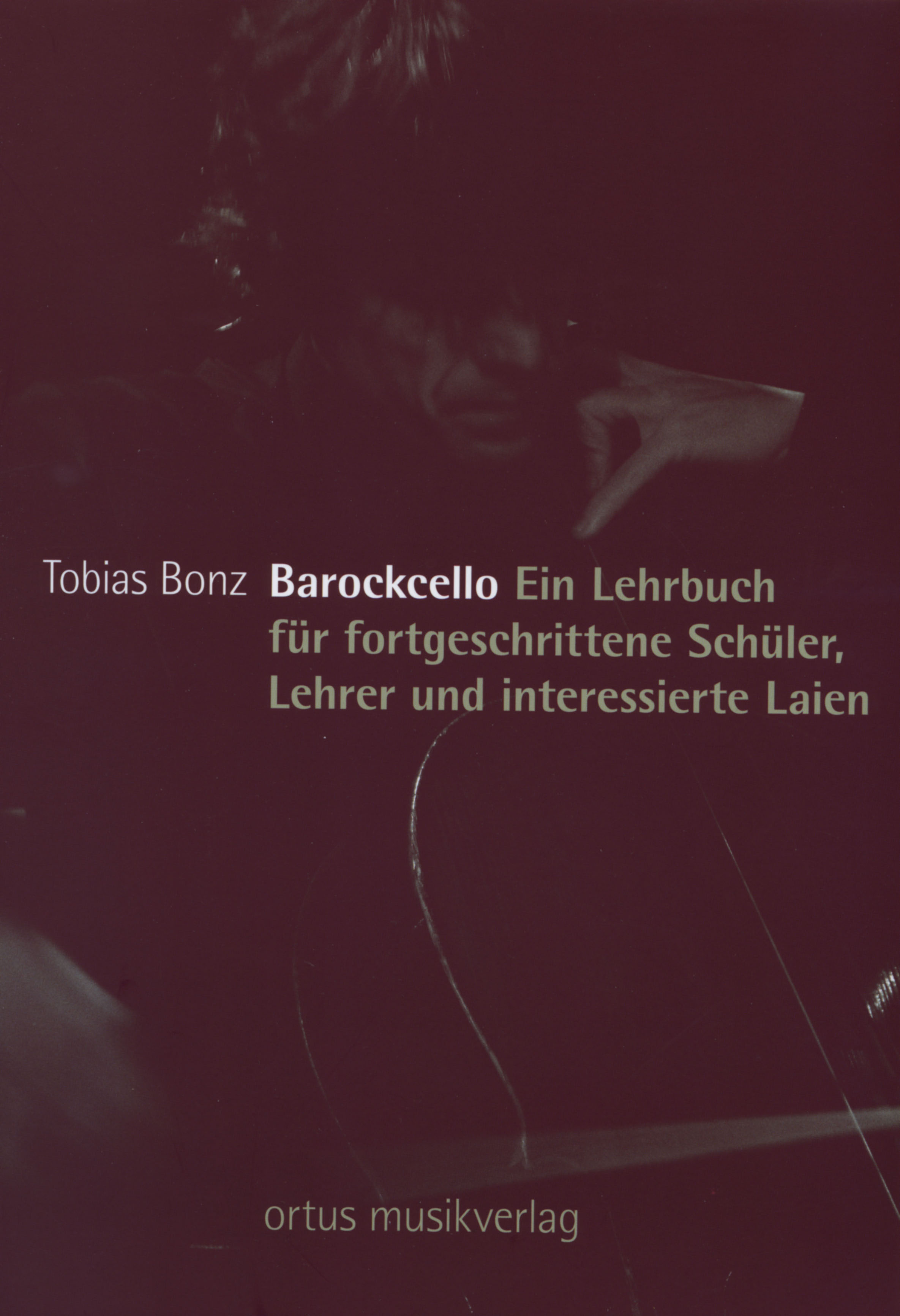Bonz, Tobias
Barockcello
Ein Lehrbuch für fortgeschrittene Schüler, Lehrer und interessierte Laien
Mit seinem Lehrbuch Barockcello unternimmt Tobias Bonz den mutigen Versuch, das Wissen (und die damit verbundenen Ansprüche) der historisch informierten Aufführungspraxis instrumentaldidaktisch so aufzubereiten, dass auch fortgeschrittene Laien davon profitieren können. Dieser Versuch war wichtig und überfällig. Denn so fraglos das Repertoire des 17. und vor allem des 18. Jahrhunderts nach wie vor eine entscheidende Grundlage der Streicherpädagogik bildet, so unübersehbar ist doch, dass die nahezu obligatorische Beschäftigung mit einer Telemannsonate oder einem Vivaldikonzert in aller Regel aus der Perspektive eines zeitlosen und stilübergreifenden Curriculums heraus erfolgt.
Die Musik der Barockzeit wird, provokant formuliert, häufig dazu benutzt, um an ihr bestimmte streicherische Grundlagen zu erlernen, auf deren Basis dann die „schwierigere“ Literatur des 19. Jahrhunderts in Angriff genommen wird. Stilistische Differenzierung wird in aller Regel zwar durchaus angestrebt, erscheint aber in den Augen der allermeisten Lehrkräfte als ein Gegenstand, der in seiner ganzen Fülle erst dann zum Zuge kommen kann und soll, wenn die „Grundlagen“ beherrscht werden.
Wie schief eine derartige Argumentation ist, wird jedem klar, der in dem vorliegenden, methodisch hervorragend aufbereiteten Lehrbuch blättert. Denn ob es um langsame oder schnelle Bogenstriche, um Arpeggien, um Martelé und Staccato, um Doppelgriffe oder Lagenspiel geht: Alles, was von der traditionellen Streichermethodik als vermeintlich „übergeordnete“ technische Basis wahrgenommen wird, entpuppt sich hier als ein Phänomenbereich, der auf das engste mit einer ganz zeitspezifischen musikalischen Sprache verbunden ist und erst aus dieser Perspektive heraus seinen Sinn erhält. Wenn es der Autor unter Zuhilfenahme vielfältiger Originalquellen seinen LeserInnen zumutet, sich auf diese Perspektive unverkürzt einzulassen, so geschieht dies weder aus aufführungspraktischem Hochmut noch aus philologischer Pedanterie heraus, sondern ist der Erfahrung geschuldet, dass erst durch die intensive Beschäftigung mit Fragen der Agogik, Phrasierung, Verzierung und Tempowahl zentrale ästhetische Dimensionen der Barockmusik zum Tragen kommen.
Natürlich provoziert der hier gewählte Ansatz eine Reihe zentraler Fragen: Lässt sich eine derart intensive und detaillierte Beschäftigung mit einem so spezifischen Thema mit den Gegebenheiten des musikschulischen Alltags vereinbaren? Ist nicht an der These, dass ein Instrument zunächst einmal grundsätzlich beherrscht werden muss, bevor man sich auf so detaillierte Fragen wie den hier verhandelten einlässt, doch etwas dran? Und müsste nicht, wenn man den Autor beim Wort nimmt, auch jede andere Epoche oder Stilistik auf eine ähnliche Weise genau behandelt werden, was den Rahmen eines jeden Instrumentalunterrichts notgedrungen überstiege?
So berechtigt diese Fragen sind, so notwendig ist es, darauf zu verweisen, dass sie in ihrer ganzen Tragweite bislang noch nicht einmal ansatzweise instrumentalpädagogisch diskutiert, geschweige denn erprobt worden sind. Aus der Perspektive des „Differenziellen Lernens“ heraus könnte man etwa entgegnen, dass gerade das bewusste Erzeugen stilistischer und technischer Differenzen bei den Lernenden ein Bewusstsein für mögliche „Lösungsräume“ entstehen lässt: die Beschäftigung mit barocken Strichkombinationen wäre danach kein Spezialgebiet, sondern eine bewusst hergestellte „Differenz“, von deren Erfahrung auch eine „romantische“ Spielweise profitieren könnte.
Ob eine auf diese Weise eingeleitete musikalische „Mehrsprachigkeit“ auf eine Überforderung oder Bereicherung instrumentalpädagogischer Arbeit hinausläuft, hängt nicht zuletzt auch mit den Zielen zusammen, aus denen heraus Instrumentalunterricht erteilt wird: Vielleicht trägt die in diesem Lehrbuch auf so überaus geschickte Weise unternommene Begegnung mit einer zunächst möglicherweise fremd anmutenden musikalischen Sprache ja zur Entwicklung jener transkulturellen Kompetenz bei, der sich musikpädagogische Arbeit heute mehr denn je verpflichtet fühlen muss?
Wolfgang Lessing