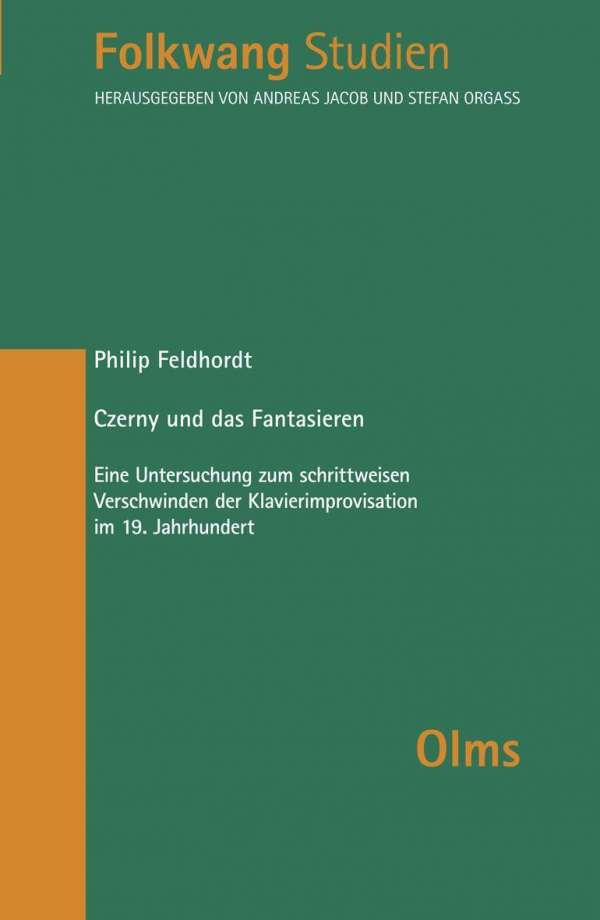Feldhordt, Philip
Czerny und das Fantasieren
Eine Untersuchung zum schrittweisen Verschwinden der Klavierimprovisation im 19. Jahrhundert
Fantasierte Czerny?
Über das allmähliche Verschwinden der Klavierimprovisation im 19. Jahrhundert
Rezension zu:
Feldhordt, Philip (2021). Czerny und das Fantasieren. Eine Untersuchung zum schrittweisen Verschwinden der Klavierimprovisation im 19. Jahrhundert. Folkwang Studien, Band 22. Hildesheim, Zürich, New York: Olms. 1108 Seiten, Hardcover, 128,00 Euro, ISBN 978-3-487-15801-3
Rezensentin: Reinhild Spiekermann
Rezension veröffentlicht am: 04.07.2022
1. Einführung
Die in zwei Bänden veröffentlichte Schrift ist eine geringfügige Überarbeitung der Dissertation, die Philip Feldhordt an der Folkwang Universität der Künste im Februar 2018 eingereicht hat. Die Überarbeitung für die Buchfassung bezieht unter anderem eine nach Fertigstellung der Dissertation erschienene, jedoch wesentliche Quelle zur Thematik ein: Dana Gooleys Fantasies of Improvisation (2018).
Für das 19. Jahrhundert ist ein Zurückweichen der pianistischen Improvisationspraxis vielfach konstatiert worden (vgl. z. B. Moore 1992, Syrbe 2010, Gooley 2018). Doch wann, unter welchen Umständen oder warum verschwand die Klavierimprovisation allmählich? Lag es an den Veränderungen im Konzertablauf, am wachsenden Schwierigkeitsgrad der Stücke, die mehr Üben erforderten, oder ging es um eine Wertentscheidung des Publikums, das das Interpretieren von Stücken dem Improvisieren vorzog? Auch die Verbreitung des Notendrucks dürfte dazu geführt haben, dass der Bedarf nach selbsterfundenen Übungen geringer wurde. Das Klavierspielen als Massenphänomen sorgte überdies für Überforderung vieler Musizierender (Feldhordt 2021, S. 21-30). Feldhordt ordnet ein, vollzieht eine erste Bewertung und fragt, ob das Klavierimprovisieren zwangsläufig verschwinden musste. Mit Blick auf seinen Protagonisten formuliert er konkret: „Was hatte nun Czerny mit dem Verschwinden der Klavierimprovisation zu tun – oder überhaupt mit Klavierimprovisation?“ (ebd., S. 31). Sein Forschungsanliegen wird dahingehend präzisiert, ob sich in Czernys Werken zur Improvisation „Symptome des schrittweisen Verschwindens“ (ebd., S. 32) nachweisen lassen. Feldhordt möchte die Frage klären, in welcher Art und Weise Czerny eine Improvisationslehre zu „betreiben“ (ebd., S. 33) versuchte, in einer Zeit, in der die Improvisation in Vergessenheit zu geraten schien.
Die Arbeit ist an der Schnittstelle von Musikwissenschaft und Instrumentalpädagogik angesiedelt, was sie zu einer inspirierenden Lektüre macht. Die Musikwissenschaft tat sich bislang schwer mit dem Gegenstand der Improvisation, sodass Christian Kaden ihn als „kategoriale[n] Geisterfahrer“ bezeichnete, den man „bisweilen auf sich zukommen“ sehe, der aber nicht „in der eigentlichen Richtung des Erkenntnisinteresses“ liege. Man wiche ihm aus und mache „es sich mit ihm leicht“ (Kaden 1993, zit. nach ebd., S. 34). Ursache dieser Verhaltensweise ist möglicherweise das „Materialproblem“, dass sich nämlich Improvisiertes einer nachträglichen Analyse entziehe. Auch ein „Kriterienproblem“ stellt sich, weil fraglich sei, ob man bei der Untersuchung von improvisierter Musik für Kompositionen genutzte Analysekriterien anlegen könne. Insofern seien Improvisationsschulen günstige Quellen, da sie das Material- und das Kriterienproblem lösen würden (ebd., S. 34-43). Während die instrumentalpädagogische Analyse von Improvisationsschulen immer auch einen praktischen Nutzen generieren soll, möchte Feldhordt hingegen Czernys Lehrwerke zur Improvisation in Beziehung zu einem historischen Prozess betrachten, nämlich dem des Verschwindens der Klavierimprovisation (ebd., S. 46).
2. Aufbau und Methoden der Untersuchung
Der Aufbau und das forschungsmethodische Vorgehen werden transparent dargestellt (ebd., S. 59-62). Es handelt sich um eine historische Untersuchung, die Material aus verschiedensten historischen Quellen, insbesondere aber Czernys Schriften zur Improvisation, analysiert. Nach Beschreibung und erster Einordnung geht es Feldhordt vor allem um eine umfassende Kontextualisierung dieser Quellen, um herauszufinden, welche Perspektive Czerny auf das Klavierimprovisieren hatte. Der sich anschließende Hauptteil der Arbeit umfasst die eigentliche Analyse der ausgewählten Quellen und ist gut 840 Seiten lang. Die ausführlichen Begriffsklärungen (ebd., S. 137-167) erfüllen hier einen doppelten Zweck. Einerseits müssen die spezifischen Begrifflichkeiten bei Czerny erläutert werden (z. B. „fantasieren“, „präludieren“), andererseits wird so ein gelungener Weg zu Czernys Denkweise beschritten. Auch hier erfolgt der neuerliche Hinweis, dass die Analyse der Quellen herausarbeiten solle, welche Aspekte in Czernys Improvisationslehre eher zum Verschwinden der Improvisationskunst geführt haben, welche jedoch möglicherweise auch einem Fortbestand hätten dienlich sein können (ebd., S. 60). Der Autor ergänzt, dass einzelne Teilkapitel des Hauptteils eine gesonderte Beschreibung methodischer Vorüberlegungen erforderlich machen. Eine Zusammenführung und Diskussion der Ergebnisse erfolgt ab Seite 433 im zweiten Band, bevor im Schlusskapitel ein Ausblick auf weiterführende Fragestellungen gegeben wird.
3. Czernys improvisationspädagogischer Ansatz
Czerny wurde in der Musikwissenschaft lange Zeit wenig beachtet. Eher beiläufig – als Beethovens Schüler und Liszts Lehrer – geriet er in den Blick der Forschung. So verwundert es nicht, dass erst in jüngerer Zeit eine Wiederentdeckung Czernys als Komponist stattfand (ebd., S. 49ff.). Die Literatur zu Czernys Improvisationslehre ist noch sehr überschaubar. Eine gründliche Analyse seiner improvisationspädagogischen Schriften wird von Feldhordt zu Recht als Forschungsdesiderat erkannt. Eine solche Analyse, so Feldhordt, könnte ferner helfen, zentrale Aspekte der Improvisationspraxis des 19. Jahrhunderts zu klären: wie sich beispielsweise die Idee des Thematischen zum improvisatorischen Zugang verhalte, ob die Fähigkeit zur Improvisation erlernbar bzw. lehrbar sein könne oder wie sich die improvisatorische Spontaneität mit der Funktionalität der gelebten Improvisationspraxis vertrage (ebd., S. 56). Für Feldhordts Forschungsanliegen sind in erster Linie Czernys schriftliche Äußerungen zur Improvisation interessant: die Systematische Anleitung zum Fantasieren, op. 200, Die Kunst des Präludierens, op. 300, und die Vollständige theoretisch-practische Pianoforte-Schule, op. 500. Hinzugezogen werden Briefe über den Unterricht auf dem Pianoforte bzw. Erinnerungen aus meinem Leben sowie diejenigen Kompositionen Czernys, die improvisationsnahen Gattungen zuzuordnen sind (ebd., S. 77).
Czernys Weg zur Improvisation ist durch frühe Einflüsse bestimmt. Ersten Unterricht erhielt er bei seinem Vater Wenzel Czerny, einem Militärmusiker. Das öffentliche Improvisieren am Klavier war äußerst beliebt, im musikalischen Wien galt Johann Nepomuk Hummel diesbezüglich als „das Maß der Dinge“ (ebd., S. 82). Als Zehnjähriger hatte Czerny Beethoven vorgespielt, der ihn aufgrund seines Talents für eine Zeitspanne von zehn Jahren gelegentlich unterrichtete. Czerny ist schlussfolgernd eher als Autodidakt zu bezeichnen, der sich an Beethoven lediglich orientierte (ebd., S. 103). Als solcher kannte er vermutlich die wesentlichen Schriften seiner Zeit. Es gibt jedoch keine Hinweise, dass er selbst jemals öffentlich improvisiert hat. Doch warum hat Czerny überhaupt eine Improvisationslehre verfasst? Hat er versucht, eine im Verschwinden begriffene Praxis zu dokumentieren oder begriffen, dass er diesem Prozess etwas entgegenzusetzen habe? Auch pekuniäre Interessen sowie das Streben nach Ruhm und Anerkennung könnten eine Rolle gespielt haben. Feldhordt resümiert (ebd., S. 134f.): „Czerny fantasierte nie öffentlich, und man weiß nicht, ob er selbst gut improvisieren konnte. In einer Zeit, in der das Improvisieren schrittweise aus dem öffentlichen Musikleben verschwand, begann er dennoch, über Improvisationen zu schreiben, und er rechnete damit, dass sich auch noch immer genügend andere dafür interessierten.“
Im 19. Jahrhundert gehörte das Fantasieren zum erklärten Aufgabenprofil eines Virtuosen (z. B. Kadenzen improvisieren, über Themen aus aktuellen Opern fantasieren), jedoch sollten nur die allerbesten Konzertpianisten damit öffentlich auftreten. Allerdings wollten zunehmend auch die Liebhaber das Improvisieren lernen. Im Bereich der Publikationen kam es in Folge zu einem Vollständigkeitsstreben: ein „umfassender Lernstoff“ sollte einer „umfassenden Zielgruppe“ dargeboten werden (ebd., S. 181).
Czerny neigte zum Systematisieren, möglicherweise weil er seinem Lernen selbst eine Struktur geben wollte (ebd., S. 191). Er löst das „Fantasieren“ in „pädagogisch handhabbare Einzelgattungen auf“ (ebd., S. 150f., zu Czernys Systematik s. auch S. 156-160). Jedoch auch Begriffe wie „Extemporieren“, „Präludieren“ oder „Improvisieren“ werden von Czerny synonym bzw. verwirrend genug auch inkonsequent gebraucht. Czernys System hat insofern eine Schwäche, da er „Fantasieren“ als Oberbegriff und Unterkategorie zugleich verwendet. Im Sprachgebrauch lässt sich vieles auf frühere Autoren zurückführen (ebd., S. 165).
Im Folgenden werden Situationen und Funktionen des Improvisierens analysiert. Feldhordt geht beispielsweise der Frage nach, ob in Czernys Improvisationslehre Möglichkeiten für eine ästhetische Bildung angelegt seien bzw. ob es ihm gelinge, Voraussetzungen zu schaffen, damit ästhetische Bildung stattfinden könne (ebd., S. 293f.). Sein Urteil fällt differenziert aus, vornehmlich die Ermutigungen zur Exploration und der Aspekt der Zweckfreiheit würden fehlen.
Eduard Hanslicks Urteil über Czerny ist bekannt und verweist auf eine gängige Rezeptions-konstante: „Czerny war ein überaus fleißiger, correcter und tüchtig geschulter Musiker, aber als Tondichter wie als Virtuose ohne jegliche Genialität“ (zit. nach ebd., S. 390). Feldhordts Analyse steigt tief ein in die Polarität, die zwischen Originalität und Pragmatismus existierte (ebd., S. 327-441). Er weist nach, dass Czerny mit Letzterem eine Strategie verfolgte, um sich im „widerspruchsvollen Feld zwischen Publikumswirksamkeit, Funktionalität und Pragmatismus auf der einen Seite und einem dann doch vorhandenen Originalitätsbewusstsein auf der anderen [Seite]“ (ebd., S. 441) souverän zu bewegen.
In seinem methodischen Vorgehen kombiniert Czerny Elemente und regt eine Auseinandersetzung mit musikalischen Mustern an. Dieses Verfahren lässt sich bereits in Vorbildern des 18. und 19. Jahrhunderts finden, ist bei ihm jedoch „stark ausgeprägt“ (ebd., S. 496). Wesentliche Schlussfolgerung aus Feldhordts Untersuchungen lauten: Czerny glaubt an eine Lernbarkeit des Improvisierens (ebd., S. 550) durch den Umgang mit „Beispielen und Mustern“ (ebd., S. 552). Seine Anleitung dazu könne man fast wie eine konkrete Ausarbeitung des letzten, „exposéartig[en]“ Kapitels von Hummels Anweisungen zum Piano-Forte-Spiel auffassen (ebd., S. 551, 554).
Nach 990 Seiten umfassender Analyse kommt Feldhordt zu dem Schluss, dass sich in Czernys Improvisationslehre „mehr Hilfreiches als Hinderliches“ finden lasse (ebd., 2. Band, S. 454), anders formuliert (ebd., 2. Band, S. 455): „Hätten sich viele Pianistinnen und Pianisten Czernys Anleitung zum Fantasieren angeschafft und hätten sie damit jahrelang gearbeitet […], dann hätten sie – so glaube ich – in einer Weise zu fantasieren lernen können, die den Ansprüchen der Zeit genügt hätte; die Klavierimprovisation wäre dann (immer noch überspitzt gesagt) nicht aus dem Konzertleben verschwunden (oder sie wäre nach einigen Jahren allgemeinen Studierens wieder aufgetaucht).“
4. Kritische Bewertung
Feldhordt gelingt – nach tadelloser Zusammenstellung bisheriger Forschungsarbeiten zu Czerny (ebd., S. 56ff.) – eine umfassende Kontextualisierung und detailreiche Analyse der relevanten Quellen. Wenn man die sehr gut lektorierten Bände aufschlägt, überrascht bereits das Inhaltsverzeichnis: Römische Ziffern, Zahlen und Buchstaben müssen herangezogen werden, um die Vielzahl an Quellen und diskutierten Aspekten schlussendlich in ein großangelegtes Gesamtbild zu überführen. Auch die Formulierungen der Kapitelüberschriften verblüffen. Einige sind nüchtern und sachlich (z. B. „Czernys Kenntnis früherer Schriften“, IV.5), andere eher beschreibend (z. B. „Dilettantinnen und Dilettanten präludieren noch immer“, V.2.2.2, oder „Der ‚Freie-Fantasie-Stil‘ war auch keine Lösung“, V.5.2.5). Es ist der erste Hinweis darauf, dass Feldhordt sich einer pointierten Sprache bedient, die das Lesen einer so umfangreichen Dissertation auf weiten Strecken vergnüglich macht (z. B. „[…] worunter allerdings wohl eher der Musikwissenschaftler leidet als der Instrumentalpädagoge“, ebd., S. 44). Der Leser wird in den meisten Kapiteln gut mitgenommen, als ob er einer Diskussion unter Experten folge. Gelegentlich gibt es etwas abrupte Abschweifungen (z. B. ein Lob für Chick Corea, ebd., S. 90), was nicht uneingeschränkt überzeugt.
Die Lektüre beider Bände erfordert viel Zeit. Es ist zu fragen, ob man bei Interesse an Einzelaspekten auch in Auszügen oder in anderer Reihenfolge lesen könnte. Feldhordt bietet hierfür eine Lösung an, in dem er an sinnvollen Stellen Zäsuren setzt und mittels überleitender Texte auf die Inhalte der nächsten Teilkapitel verweist. Dies geschieht mustergültig z. B. auf S. 441 (Band 1) am Ende von V.5. Inhaltlich vorbereitet werden auf diese Art die Kapitel V.6-V.9.
Nicht immer erschließt sich jedoch auf den ersten Blick, wie verfahren wird. Auf den Seiten 203ff. werden „Vorüberlegungen“ zu Kriterien für die Untersuchung von Situationen und Funktionen des Improvisierens angestellt. In der Folge gibt es drei Teilkapitel, die die Überschrift „Situationen des Improvisierens“ tragen, was zunächst verwirrend ist. In der Einführung zu V.4 sind es dann „methodische“ Vorüberlegungen zu Kriterien (ebd., S. 291) zur Untersuchung von Bildungsaspekten.
Aus der Instrumentalpädagogik werden mit Peter Röbke und Anselm Ernst prominente Vertreter herangezogen, zunächst, um deren pädagogische Kriterienkataloge zu nutzen (ebd., S. 295). Jedoch orientiert sich später Kapitel V.6 (ebd., S. 443-556), das Czernys didaktischen Ansatz analysiert, primär an Ernst, dessen 1991 erschienenes Lehren und Lernen im Instrumentalunterricht (hier in der Neuauflage 2012 genutzt) zwar wegweisend für die Entwicklung in der Instrumentalpädagogik war, jedoch inzwischen wichtige Nachfolger gefunden hat. Wahrscheinlich wäre es zu viel verlangt, wenn die Bezugsliteratur den aktuellen Stand in der Instrumentalpädagogik abbilden würde. Allerdings muss man konstatieren, dass Feldhordts Arbeit deshalb nicht ganz auf der Schnittstelle von Musikwissenschaft und Instrumentalpädagogik anzusiedeln ist, sondern eher auf Seiten der Musikwissenschaft. Sie ist ein wichtiger Beitrag, um im schwierigen Verhältnis von Musikwissenschaft zur Improvisation dem „Diffusen des Diskurses“ (ebd., S. 40) eine fundierte Arbeit entgegenzusetzen. Feldhordts Anspruch war, Czernys Lehrwerke in Beziehung zu einem historischen Prozess zu betrachten, nämlich dem des (angenommenen) Verschwindens der Klavierimprovisation. Das ist ihm uneingeschränkt gelungen!
5. Ausblick
Wurden in Feldhordts Untersuchung Czernys improvisationspädagogische Werke in ihrem Verhältnis zum Prozess des Verschwindens der Klavierimprovisation aus dem öffentlichen Konzertleben des 19. Jahrhunderts untersucht, wäre es lohnenswert, in weiterführenden Studien nach praktischen Konsequenzen von Czernys improvisationspädagogischer Tätigkeit als Autor und Lehrer zu suchen. Feldhordt gelingt in seinem Schlusskapitel ein knapper Ausblick auf mögliche Anschlussforschungen: Fragen zur Rezeption von Czernys Texten, aber auch die Idee, dass unter Czernys Schülern Hinweise zur Umsetzung der improvisationspädagogischen An-liegen zu finden sein müssten, werden beleuchtet. Da Liszt der einzige Schüler Czernys war, dessen Improvisationskunst als herausragend galt, diskutiert Feldhordt an dieser Stelle Intensität und Richtung der gegenseitigen Beeinflussung von Czerny und Liszt. Beruhten etwa Czernys pädagogische Veröffentlichungen zur Ausbildung der Virtuosität auf seinen Erfahrungen mit dem jungen Liszt als Schüler (so die These von James Andrew Deaville, s. ebd., 2. Band, S. 468)? Hat Liszt gar mehr Einfluss auf Czerny ausgeübt als umgekehrt (gemäß der These Jim Samsons, s. ebd., 2. Band, S. 469)? Feldhordt geht noch einen Schritt weiter ins Spekulative, wenn er fragt, ob Czerny mit dem Verfassen seiner Anleitung zum Fantasieren sein eigenes Scheitern als Pianist, mit dem er sich in der Begegnung mit Liszt konfrontiert gesehen haben muss, kompensatorisch verarbeitet habe. Liszt könnte somit für Czerny der Anlass gewesen sein, das Improvisieren zu didaktisieren (ebd., 2. Band, S. 473). Auch wenn diese Fragen nicht abschließend beantwortet werden können, könnte man ihnen mit „improvisationsspezifischen Analysen“ (ebd., 2. Band, S. 473) Liszt’scher Klavierwerke in ihrem Verhältnis zu Czernys Improvisationslehre weiter auf die Spur kommen.
Spannend wäre in der Tat die Frage, ob man Czernys Improvisationslehre auch heute nutzen könnte, um das Improvisieren zu lehren oder zu lernen. Die Instrumentalpädagogik wäre um ein Forschungsanliegen reicher!
Literaturverzeichnis
Czerny, C. (1833). Die Kunst des Präludierens. op. 300, Wien, Bayerische Staatsbibliothek, Sign. 4 Mus.pr. 11435.
Czerny, C. (1968). Erinnerungen aus meinem Leben. Hg. und mit Anmerkungen versehen von W. Kolneder, Sammlung musikwissenschaftlicher Abhandlungen, Band 46. Strasbourg und Baden-Baden: Heitz.
Czerny, C. (1988). Briefe über den Unterricht auf dem Pianoforte vom Anfange bis zur Ausbildung als Anhang zu jeder Clavierschule. Wien [ca. 1840], Reprint, Straubenhardt: Antiquariat-Verlag Zimmermann.
Czerny, C. (1991). Von dem Vortrage. Dritter Teil aus „Vollständige theoretisch-practische Pianoforte-Schule“. op. 500, Wien [ca. 1846], Reprint, hg. und mit einer Einleitung versehen von U. Mahlert, Wiesbaden: Breitkopf & Härtel.
Czerny, C. (1993). Systematische Anleitung zum Fantasieren auf dem Pianoforte. op. 200, Wien 1829, Reprint, hg. und mit einer Einleitung versehen von U. Mahlert, Wiesbaden: Breitkopf & Härtel.
Ernst, A. (2012). Lehren und Lernen im Instrumentalunterricht. Ein pädagogisches Handbuch für die Praxis. Mainz: Schott.
Gooley, D. (2018). Fantasies of Improvisation. Free Playing in Nineteenth-Century Music. New York: Oxford University Press.
Hummel, J. N. (1989). Ausführliche theoretisch-practische Anweisung zum Piano-Forte-Spiel vom ersten Elementar-Unterrichte an bis zur vollkommensten Ausbildung. Wien [1838], Reprint, Straubenhardt: Antiquariat-Verlag Zimmermann.
Kaden, C. (1993). Des Lebens wilder Kreis. Musik im Zivilisationsprozess. Kassel: Bärenreiter.
Moore, R. (1992). The Decline of Improvisation in Western Art Music. An Interpretation of Change. International review of the aesthetics and sociology of music, 23(1), 61–84.
Syrbe, M. (2010). Improvisation im Klavierunterricht von Barock bis Romantik. Zur Bedeutung des Musizierens ohne Noten anhand verschiedener Lehrwerke des 17. bis 19. Jahrhunderts. Saarbrücken: VDM.
Reinhild Spiekermann
Hochschule für Musik Detmold
Neustadt 22
32756 Detmold
E-Mail: re******************@*********ld.de
Forschungsschwerpunkte: Erwachsene im Instrumentalunterricht bzw. in der Kammermusik, Instrumentalgeragogik, Intergeneratives Musizieren, Professionalisierung des Berufsfeldes von Instrumentalpädagog*innen