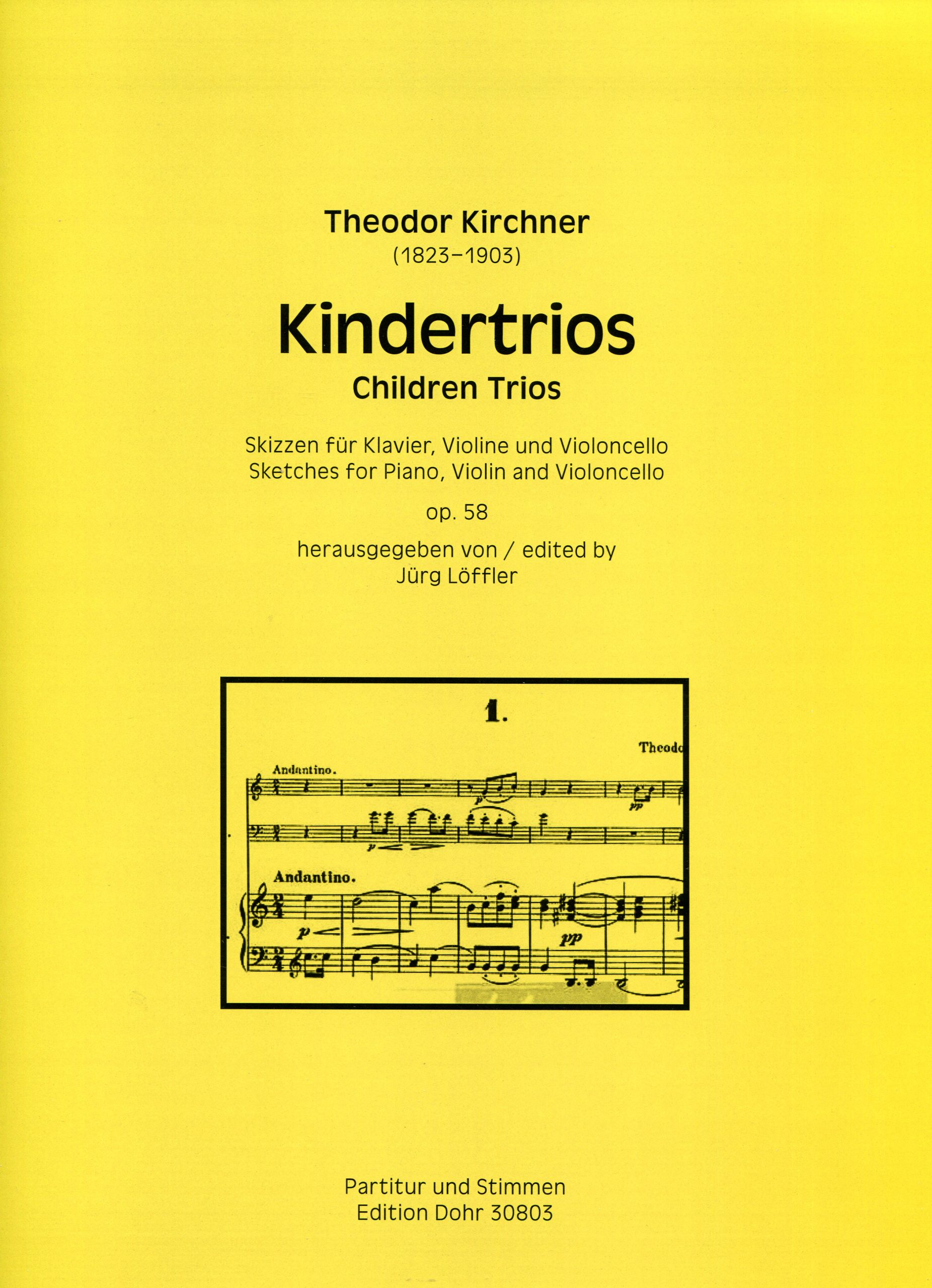Kirchner, Theodor
Kindertrios
Skizzen für Klavier, Violine und Violoncello op. 58, hg. von Jürg Löffler, Partitur und Stimmen
Der 1823 bei Chemnitz geborene Theodor Kirchner war ein ungemein fruchtbarer Komponist, wenn er auch in der heutigen Wahrnehmung oft geringschätzig als Kleinmeister und Epigone abgewertet wird. Ersteres hat einen wahren Kern, denn Kirchner beschränkte sich weitgehend auf die kleinen Formate: So sind etwa tausend Charakterstücke für Klavier von ihm überliefert. Letzteres (Vor-)Urteil wäre zu überprüfen: Immerhin wurde Kirchner als Jungtalent von Mendelssohn und Schumann gefördert und geschätzt, und mit Clara Schumann verband Kirchner später eine zeitweilige, mit Johannes Brahms eine lebenslange Freundschaft.
Ein eigenartiger Fall liegt bei Kirchners op. 58 vor, den Kindertrios für Klavier, Violine und Violoncello, denn diese existieren auch in einer leicht abweichenden reinen Klavierfassung. Hierbei ist nicht eindeutig, was Original, was spätere Bearbeitung ist. Als „Skizzen“ sind die Kindertrios im Untertitel bezeichnet, und das trifft zu, was die Länge der einzelnen Stücke betrifft, in denen oft nur ein einziger Gedanke ausgeführt wird. Die meisten der 15 Stücke nehmen im Druck eine Partiturseite ein; größere dreiteilige Formen mit einem Trio in der Mitte gibt es lediglich zweimal: bei der scherzoartigen Nr. 2 und bei dem wie ein Walzer beginnenden vorletzten Stück.
Wie man bereits anhand dieser Beschreibung vermutet, verzichtete Kirchner auf poetische Einzeltitel. Herkömmlich italienische, manchmal auch deutsche Tempoangaben wie „Einfach. Ruhig“ müssen als Fingerzeige für die Interpretation der einzelnen Charakterstücke genügen; und nur einmal liest man ein konkreteres „Etwas betrübt“. Ansonsten, wenn man die Bezeichnung Kindertrios im musikpädagogischen Sinn deutet, kann man sehr wohl konstatieren, dass die technischen Herausforderungen an die SpielerInnen begrenzt sind. Eine feine Auffassungsgabe ist trotzdem gefordert, denn der Tonartenkreis weicht zwar nicht allzu weit vom Zentrum C-Dur ab (ein Stück in As-Dur mit seinen vier Vorzeichen ist die Ausnahme), doch begegnen den SpielerInnen manch unerwartete harmonische Wendungen und einmal im Wechsel von 3/4- und 2/4-Takt auch die Herausforderung, die verschiedenen Metren sinnvoll aufeinander zu beziehen.
Jürg Löffler, der schon mehrfach Werke Theodor Kirchners herausgegeben hat, kann sich bei seiner kritischen Edition auf zwei Quellen stützen: dem Handexemplar der Erstausgabe von 1882 (mit kleinen Korrekturen des Komponisten) und, sekundär, das Manuskript der Klavierfassung. Vielleicht etwas gewagt, aber nicht falsch ist es, wenn Löffler in seinem Vorwort Kirchners romantische Charakterstücke als musikgeschichtlich zukunftsträchtig einordnet: „Der musikalische Aphorismus und die zunehmende Verdichtung der Form finden in der Zweiten Wiener Schule ihre Weiterführung.“
Gerhard Dietel