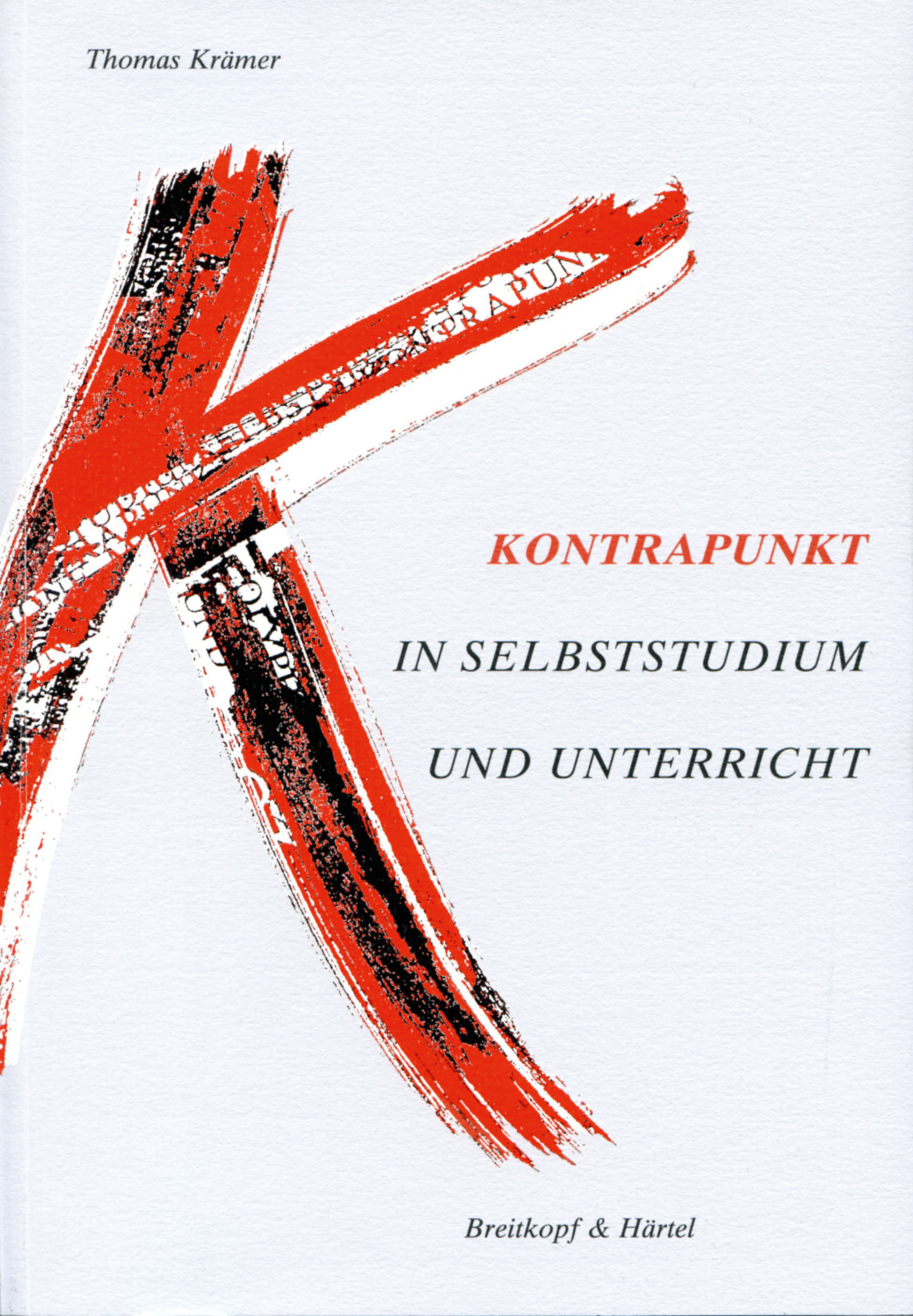Krämer, Thomas
Kontrapunkt
Polyphone Musik in Selbststudium und Unterricht
Ein weiteres Buch zu einer historischen Satztechnik? Der Autor, Hochschullehrer für Musiktheorie, möchte sich von der Tradition der Kontrapunktlehren absetzen, indem er die Stilkopie, das Selbstschreiben, als methodischen Königsweg in den Vordergrund stellt. Systematisierende, musikwissenschaftliche Zugänge werden laut Vorwort ausgeschlossen: Das Buch wurde „für Musiker“ geschrieben und ist für das Selbststudium gedacht.
Ein ambitioniertes Unterfangen – und tatsächlich beeindruckt die Kombination aus stilkundlich orientierten Analysen, satztechnisch ausgerichteten Schreibübungen und ausführlichen Untersuchungen an Originalkompositionen der jeweils untersuchten Genres und Epochen, die in dieser Fülle bisher kein Kontrapunkt-Lehrbuch aufweist. Zum beachtlichen Umfang von 488 Seiten trägt auch das Anliegen des Autors bei, Kontrapunkt in größere Zusammenhänge und Vernetzungen mit Harmonielehre und Generalbass zu stellen und ihn von der Rolle einer isolierten Disziplin zu befreien. So gibt es einen Vorkurs in Allgemeiner Musiklehre und Exkurse zu Textierung, Harmonielehre und Generalbass, die den Rahmen weit stecken. Alle wichtigen Gattungen der jeweiligen Stilbereiche werden behandelt. Mit zunehmender Komplexität nimmt allerdings der rein analysierende Anteil zu.
Alle Kapitel enthalten Aufgaben: „klassische“ Satzaufgaben nach Fux’schem Vorbild, Korrekturaufgaben fehlerhafter Vorlagen sowie Lückenaufgaben zu Originalkompositionen. Der Lösungsteil umfasst 70 Seiten; allerdings werden dem Leser als Lösungen zu den Lückenaufgaben von Originalbeispielen meist unkommentierte Komplettfassungen der Originale gezeigt.
Der Aufbau der Kapitel folgt strikt der ansteigenden Stimmenzahl: Der Einstimmigkeit wird breiter Raum gewährt, sodann wird jede Stimmenzahl bis zur Sechzehnstimmigkeit behandelt, und zwar jeweils in ihren Ausprägungen und typischen Gattungen vom 15. bis zum Ende des 19. Jahrhunderts. Dabei spielen naturgemäß die polyfonen Kompositionen der Renaissance und des Barock die wichtigste Rolle.
Das Gros der satztechnischen Übungen folgt der seit Fux üblichen Systematik der Kontrapunkt-„Gattungen“ vom Satz Note gegen Note über kürzere und gemischte Notenwerte bis hin zum „floridus“ in verschiedenen Kombinationen und ansteigender Stimmenzahl. Der einstimmigen Linie wird besondere Sorgfalt gewidmet. Dies führt bisweilen zu fragwürdigen Ergebnissen, weil manche melodisch-rhythmischen Wendungen erst in Stimmkombinationen ihren Sinn offenbaren. Bedenklich erscheint auch der Ansatz, eine melodisch bewegte Einzelstimme eines polyfonen Werks aus dem 16. Jahrhundert als Ausfiguration einer einstimmigen Ganze-Noten-Linie zu interpretieren.
Der Menge des Stoffs, die umfassende Berücksichtigung aller Gattungen und die Fokussierung auf satzpraktische Aspekte führen zu recht knapper Behandlung einzelner Phänomene, etwa beim Palestrina-Stil, der nicht durch einige elementare kontrapunktische Anweisungen zu fassen ist, oder bei der vierstimmigen Fuge für Tasteninstrumente, die, obwohl als Königsdisziplin bezeichnet, auf nur sieben Seiten behandelt wird. Auch auf eine systematische, tiefgehende Darstellung stilistischer Aspekte (Figurenlehre, seconda prattica, latente Mehrstimmigkeit und anderes) wird meist verzichtet.
Den „künstlichen“ Satz-Etüden werden jeweils Beispiele aus komponierter Musik der jeweiligen Gattung und Epoche gegenübergestellt, wobei die qualitativen Unterschiede zwischen der „lebendigen“ Musik und der regelkonform ausgeführten Tonsatz-Etüde sehr deutlich werden. Musikalische Qualität, schwer durch Regeln oder Stilanalyse fassbar, tritt in den Originalbeispielen autonom zu Tage, und zwischen diesen und den korrekten Lösungsversionen der Tonsatz-Etüden tut sich eine fühlbare didaktische Distanz auf.
Zunehmend fraglich wird das Prinzip der Lückenaufgabe an Originalbeispielen bei Barock und Klassik: Zu einem wirklichen Verständnis der Melodiestile im Wandel der Epochen und einem souveränen kompositorischen Umgang mit ihnen wäre eine viel tiefergehende Behandlung der Stilmerkmale nötig. Und so wirken Aufforderungen wie „Schreibe eine vierstimmige Fuge für Orgel über ein Thema von Max Reger“ doch ein wenig treuherzig.
Fazit: Ein gut lesbares, umfangreiches Lehrbuch, dessen umfassender Anspruch oft Knappheit in Einzeldarstellungen zur Folge hat und das deshalb eher für den Unterricht als für das Selbststudium geeignet erscheint. Dem Autor ist es aber gelungen, Kontrapunkt aus seiner Rolle als isolierte Disziplin zu lösen und in kompositorische Gesamtzusammenhänge einzubinden.
Christoph Hempel