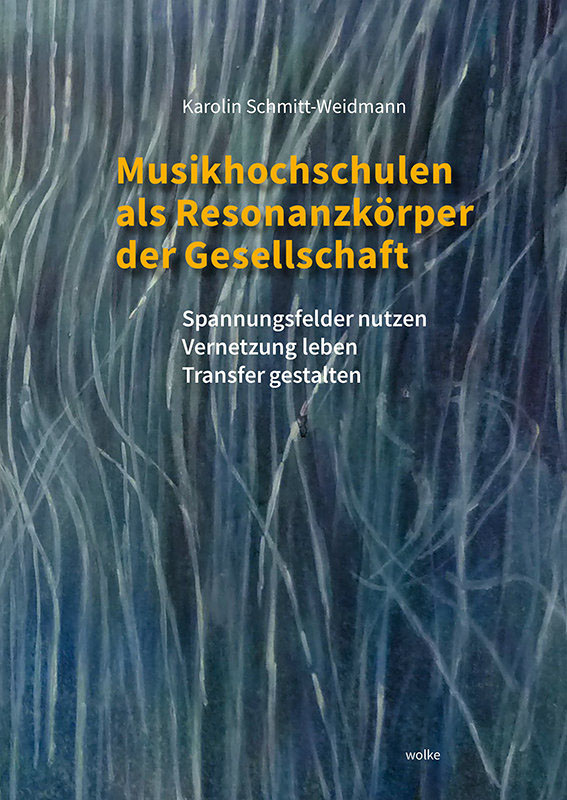Schmitt-Weidmann, Karolin
Musikhochschulen als Resonanzkörper der Gesellschaft
Spannungsfelder nutzen – Vernetzung leben – Transfer gestalten
Mit dieser Veröffentlichung legt Karolin Schmitt-Weidmann eine ebenso anspruchsvolle wie zeitgemäße Untersuchung vor, die die Rolle und Zukunft von Musikhochschulen in den Fokus rückt. Im Kontrast zum Bild des isolierten Elfenbeinturms versteht sie Musikhochschulen als integralen, potenziell hochgradig wirksamen Teil der Gesellschaft. Ihre zentrale Forschungsfrage lautet demnach, wie Studierende dazu befähigt werden können, als verantwortungsvolle Persönlichkeiten Kultur und Gesellschaft in transdisziplinären Kontexten aktiv und flexibel mitzugestalten.
Das Buch ist in drei Hauptteile gegliedert. Es widmet sich im ersten Kapitel der Verbindung von Nachhaltigkeit, Bildung und Kunst und führt zentrale Begriffe wie Resonanz (Hartmut Rosa) und transformative Bildungsprozesse ein. Kapitel 2 analysiert typische Spannungsfelder im Hochschulalltag wie etwa Tradition versus Innovation, Lehren versus Begleiten oder Freiheit versus Kontrolle.
Im Fazit im dritten Teil wird eine Vision für die Musikhochschule der Zukunft skizziert, die auf den Treibern lebenslangen Lernens, einem kreativen Umgang mit Spannungsfeldern und disziplinübergreifender Vernetzung basiert. Kollaboration wird zum Schlüsselwort, die Integration von Forschung, Lehre und gesellschaftlichem Engagement zur unausweichlichen „One Mission“. Konkrete Fallbeispiele aus den Musikhochschulen Stuttgart und Detmold zeigen, dass dies keine Utopie bleiben muss.
Das Buch zeichnet sich durch hohe Aktualität, seine transdisziplinäre Herangehensweise sowie durch theoretische Vielfalt und Tiefe aus. Zudem zeugt Schmitt-Weidmanns Übertragung der gewählten Diskurse auf den Alltag und eine mögliche Zukunft von Musikhochschulen von einem tiefen, multiperspektivischen Verständnis für die Komplexität dieser Institution.
Anzumerken ist, dass der anspruchsvolle akademische Textstil möglicherweise die Zugänglichkeit der zukunftsweisenden Ideen für eine breitere Leserschaft einschränkt. Darüber hinaus wäre es eine spannende Ergänzung, praktische Herausforderungen bei der Umsetzung der vorgestellten Visionen innerhalb bestehender, oftmals starrer Machtstrukturen und persönlicher Überzeugungen tiefgreifender zu beleuchten.
Insgesamt handelt es sich bei diesem Buch um ein inspirierendes Plädoyer, Musikhochschulen zeitgemäß zu denken und ihre Potenziale als lebendige „Resonanzkörper“ in und für die Gesellschaft voll auszuschöpfen. Das Buch verbindet theoretische Tiefe mit praktischer Relevanz und formuliert eine klare Vision. Dies macht es zu einer wertvollen Lektüre für alle, die sich mit der Leitung, Gestaltung und Weiterentwicklung von Musikhochschulen befassen – von Rektoraten über Lehrende und Studierende bis hin zu Akteuren in der Kulturpolitik.
Maria Anna Waloschek