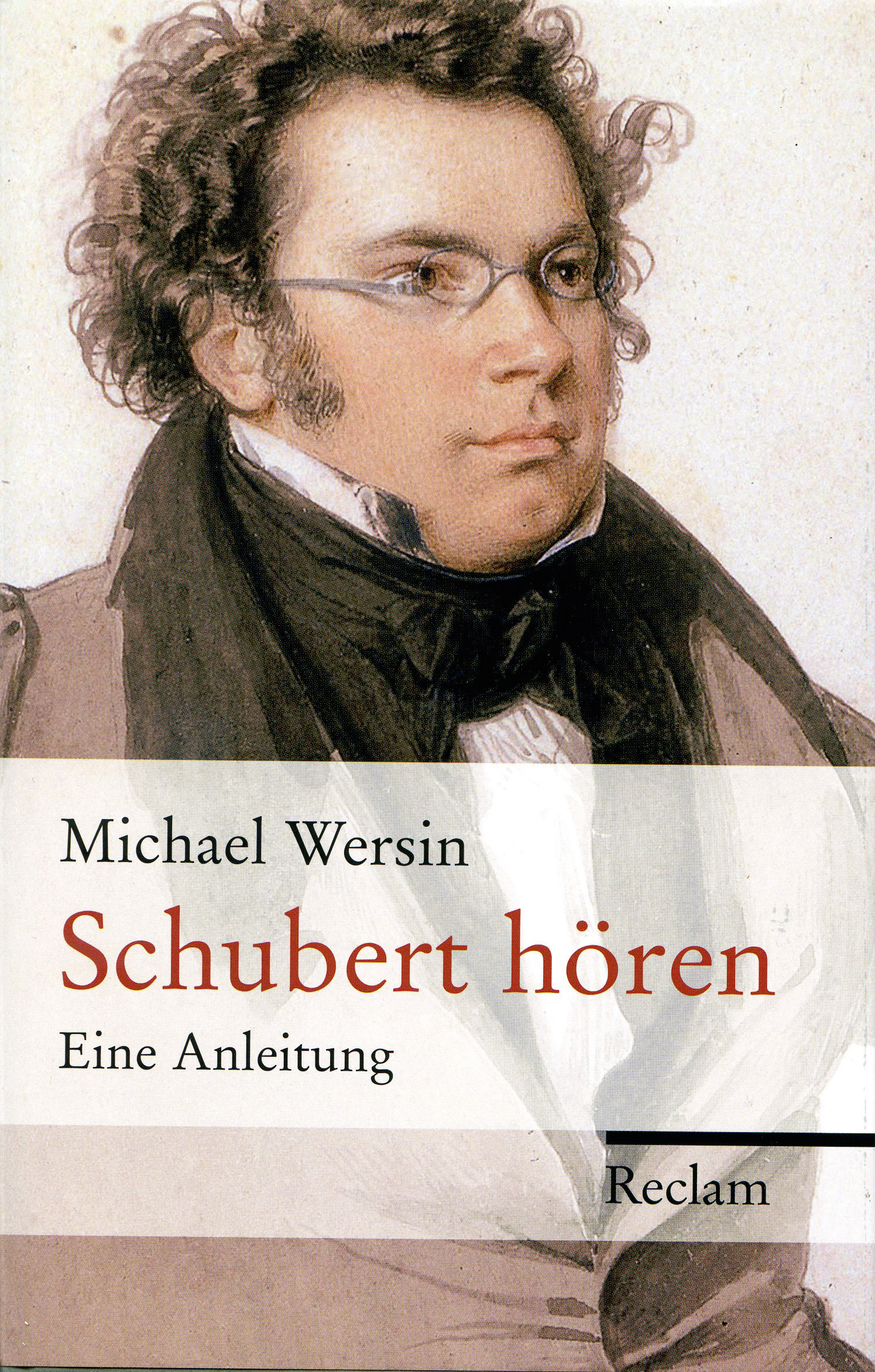Wersin, Michael
Schubert hören
Eine Anleitung
Braucht es heutzutage schon eine Anleitung zum Hören der Werke Franz Schuberts? Ist seine Musik uns etwa fremd geworden? Nein, so weit ist es noch nicht. Der Autor meint ja selbst, Schuberts Musik spräche „keineswegs auf abstrakte, sondern vielmehr auf sehr persönliche Weise zu uns“.
Blickt man in das Buch, gewahrt man neun Kapitel, die schlaglichtartig und kompilatorisch Themen behandeln, welche allgemein einen bekannten Schubert – seine Biografie und seine Musik – und dessen Umfeld beleuchten.
Daneben hilft Wersin den LeserInnen, sich „anhand einiger aussagekräftiger Beispiele“ in Schuberts Tonsprache vertiefen zu können, wofür er in den einzelnen Kapiteln stellvertretend Gretchen am Spinnrade D118, die „Unvollendete“, die Klaviersonate c-Moll D958, das Adagio des Streichquintetts C-Dur D956 und Die Winterreise D911 herausnimmt und die ausführlichsten Besprechungen am Ende des Kapitels mit Musikbeispielen veranschaulicht. Außerdem stellt er jene Menschen in den Fokus, die direkt oder indirekt Einfluss auf Schubert ausübten, wie Antonio Salieri, Johann Michael Vogl, Franz Grillparzer und Wilhelm Müller, die zudem für eine gewisse Geisteshaltung standen.
Wersin weiß aber auch, wie heikel die Frage nach den Beziehungen zwischen Leben und Werk ist, da man „schnell in das seichte Gewässer jener Klischees“ gerät, die vor allem die ältere Schubert-Biografik bedient. Allerdings verheddert er sich auch in eines, als er den Spaun’schen Bericht über die Entstehung des Erlkönigs D328 zitiert. Und das, obwohl er später eingehend über Schuberts schwierig nachzuvollziehenden Kompositionsprozess reflektiert. Anhand des Erlkönigs mit seinen fünf Fassungen hätte er diesen Bericht anschaulich entwerten können. Außerdem war er dabei, mit jenem Klischee aufzuräumen, Schubert habe in einem Zustand von Somnambulismus, also schlafwandlerisch, komponiert.
Trotzdem versucht Wersin geschickt – wie manche vor ihm –, festgefahrene Denkmuster zu entpopularisieren, wie die gängige Meinung, Schubert habe bis zuletzt im Schatten Beethovens gestanden. Gerade anhand obiger Klaviersonate, an der er angeblich gescheitert war, versucht der Autor zu zeigen, wie nahe sich Schubert absichtlich „an Beethoven heranbewegt hat, um gerade durch diese Nähe mit größtmöglicher Deutlichkeit sichtbar zu machen, was ihn grundlegend von Beethoven trennt: Es handelt sich um einen Akt der bewussten künstlerischen Abgrenzung… Es ist, als wolle er damit auf einen grundsätzlichen Wesensunterschied … verweisen.“ Schubert zeigte somit, dass er auch hierin sein einst großes Vorbild überwunden hatte und bis zuletzt „auf der Höhe seiner Schaffenskraft war und kaum mit seinem Ende rechnete“.
Werner Bodendorff