Sommerfeld, Jörg
Zurück in die Zukunft
Die Instrumentalpädagogik im Jahr 2030 – eine Vision?
Es bleibt nur noch wenig Zeit als Musikschullehrer, denn 2034 erreiche ich tatsächlich das Rentenalter. Aber so richtig kann ich mich noch nicht auf den Ruhestand freuen, denn gerade in den vergangenen zehn Jahren von 2020 bis 2030 gab es noch so unglaublich viel Neues in meinem Beruf, dass ich gerne noch etwas länger gearbeitet hätte…
Die Entwicklung begann in den 2020er Jahren. Einen einzelnen Auslöser gab es damals nicht, es war ein Zusammenwirken ganz unterschiedlicher Impulse. So drängten etwa nach den Veränderungen in den Studiengängen der Musikhochschulen nach und nach immer mehr hochqualifizierte InstrumentalistInnen in den Markt. Sie hatten einen musikpädagogischen Masterabschluss, nicht selten sogar eine Promotion, und trotzdem keine Chance auf eine Festanstellung in Vollzeit – um von den damals üblichen Gehältern und Honoraren gar nicht erst zu reden.
Ein zweiter wichtiger Anstoß war die sich sehr plötzlich ändernde Erlasslage in den Schulen. Nachdem Anfang des Jahrtausends viele Musikschulen ihren Betrieb in Kooperationsprogrammen eng mit dem Schulsystem verwoben hatten, entstand eine große strukturelle und finanzielle Abhängigkeit. Ohne Schulkooperationen waren Musikschulen nicht mehr finanzierbar und organisierbar, schon allein wegen der inzwischen fast überall entstandenen Ganztagsschulen war eine Zusammenarbeit unumgänglich.
Irgendwann gab es dann den Fall, dass ein Instrumentallehrer gegenüber Schülerinnen übergriffig wurde. Dessen Auswirkungen konnte anfangs niemand absehen. Wie sich nämlich zeigte, war dieser Instrumentallehrer über einen Honorarvertrag bei der Musikschule beschäftigt, was die Boulevardpresse zum „Hilfslehrerskandal“ mit immer mehr Beispielen aus ganz Deutschland über Monate hinweg mehr und mehr aufbauschte. Der letztlich daraus folgende Beschluss der Kultusministerkonferenz zu außerschulischen Kooperationspartnern führte dazu, dass Musikschulen allerhöchste Anforderungen an die pädagogische, fachliche und menschliche Qualität ihres Personals stellen und das auch dokumentieren mussten, etwa durch Weiterbildungen und Zertifizierungen. In einigen Bundesländern müssen seitdem externe Lehrkräfte im Schulsystem, wie es die InstrumentalpädagogInnen sind, sogar mit Unterrichtsbesuchen und Bewertungen durch die Schulbehörden rechnen.
Eine neue Standesorganisation
Die dritte und vielleicht die wesentliche treibende Kraft war der neue „Deutsche Instrumental- und Gesangslehrerverband“ (DIGV), den jüngere KollegInnen daraufhin gründeten und der durch einige kluge Entscheidungen Katalysator der nachfolgenden Entwicklungen wurde.
Dieser neue Verband stellte das System der Instrumentalpädagogik auf den Kopf. Oder vom Kopf wieder auf die Füße, wie viele damals sagten. Der Slogan lautete: „Fachdidaktik ist Lehrersache“. Diese einfache Formel brachte es auf den Punkt und mobilisierte die fähigsten Köpfe, ihr Wissen über das Was und Wie in der Instrumentalausbildung zu dokumentieren, zu teilen und zu diskutieren. Es ging im neuen Berufsverband zunächst nicht um Tarifverträge oder eine Rechtsvertretung der Mitglieder, sondern es ging um die Sache des Musik-Unterrichtens selbst. Mit großer Begeisterung fanden viele berufserfahrene Fachleute und hochqualifizierte BerufsanfängerInnen hier ihr Forum. Die meisten Musikhochschulen haben damals erst sehr spät erkannt, dass sie mit ihren Studierenden ja nur einen ganz kleinen Ausschnitt des Berufsfelds kennen. Ihre Fokussierung auf die Nachwuchsausbildung verhinderte, dass die sie den enormen Wissens- und Könnens-Vorsprung erfahrener Lehrkräfte überhaupt wahrnahmen.
Der neue Verband war von einem „reflektierenden Pragmatismus“ geprägt, ein Schlagwort der Erziehungswissenschaften der damaligen Zeit. Zuerst wurde das Allernötigste angegangen: die Beschreibung der verschiedenen Fachdidaktiken in modernen Lehrplänen. Das Wissen um Ziele und Möglichkeiten in den verschiedenen Fächern, ihre genaue und praxisbezogene Beschreibung und vor allem die darauf abgestellte umfassende Notendatenbank brachten endlich ein flächendeckendes curriculares Verständnis ins System. Die Verlage mussten ihre Schülerausgaben in dieser Datenbank detailliert dokumentieren, um weiterhin nennenswerte Verkaufszahlen zu erreichen. Lehrkräfte konnten nun mit Lehrplan und Notendatenbank sehr differenziert nach geeignetem Unterrichtsmaterial für jede Gruppe und jeden Schüler suchen.
Die neuen Lehrpläne wurden fast schon basisdemokratisch von allen DIGV-Lehrkräften gemeinsam entwickelt. Sie enthalten inzwischen Kompetenzstufenmodelle für die verschiedensten Fächer, Unterrichtsformen und Ensembles. Der Verband sorgte nach und nach für eine immer bessere empirische Fundierung dieser meist von Praktikern entwickelten Modelle. Vor allem die vielen darauf bezogenen Empfehlungen und praxisbezogenen Kommentierungen von Unterrichtsmaterial führten dazu, dass immer mehr KollegInnen ihren Unterricht freiwillig an den neuen Plänen ausrichteten. Am Ende wurden die neuen Lehrpläne zum Standard erhoben, der Verband deutscher Musikschulen (VdM) stellte sein Lehrplanwerk ein und verwies auf das des neuen Berufsverbandes.
Zertifizierung der Lehrkräfte
Engagierte Köpfe im DIGV erkannten schnell, dass die Anwendung eines Lehrplanwerks allein noch keine Garantie für guten Unterricht war. Nach dem „Hilfslehrerskandal“ konnten sie jedoch erhebliche öffentliche Mittel bekommen, um nach eigenen Vorstellungen eine Weiterbildung und Zertifizierung von Lehrkräften zu entwickeln. Mit diesen Geldern konnte man auf einmal inhaltlich gestalten, Fortbildungen organisieren, fachdidaktische Tagungen und Kongresse durchführen und vor allem den Unterricht nach eigenen Kriterien evaluieren. Es ging nun überall um die detaillierte Beschreibung und Entwicklung der professionellen Lehrkompetenzen, die in einem Zertifikat dokumentiert werden sollten.
Die damals sehr umstrittene Bestimmung, dass nur Lehrkräfte mit mindestens sechs Jahren Berufserfahrung für diese Zertifizierung in Frage kamen, hat sich am Ende als genau richtig herausgestellt. Nach einigen Jahren im Beruf kann man sich nun als eine Art „High-Impact-Teacher“ zertifizieren lassen. Die Hürden sind hoch, und schon die Zulassung zum Verfahren gilt inzwischen als Auszeichnung. Aber die Chance, nach einigen Jahren seine subjektive Berufserfahrung nochmals zu überprüfen und weiterführende Methoden auch zur Evaluation des eigenen Unterrichts an die Hand zu bekommen, setzt Dynamik und Motivation frei.
Dabei ist die Zertifizierung anspruchsvoll und zeitaufwändig. Über zwei Jahre müssen Kandidaten mit ausgewählten Unterrichtsreihen in den unterschiedlichsten Szenarien ihr Können weiterentwickeln und dokumentieren. Videografie spielt dabei eine wichtige Rolle und wurde zum Standard in der Unterrichtsbeobachtung, als fast alle Smartphones mit 360-Grad-Kameras ausgeliefert wurden. Zertifizierte InstrumentallehrerInnen sind heute gefragter denn je, viele von ihnen werden nun auch direkt in allgemein bildenden Schulen angestellt, nachdem die Zertifizierung des DIGV im Jahr 2029 von der Kultusministerkonferenz einem abgeschlossenen Referendariat gleichgestellt wurde.
Der Beschluss der Kultusministerkonferenz hatte seinen Grund im Mangel an geeignetem Musiklehrernachwuchs, er war aber natürlich bei den Schulmusikern heftig umstritten. Es war bereits seit vielen Jahren üblich, dass Schulmusiker im Klassenmusizieren oder in der Orchesterarbeit auch Instrumentalpädagogik betrieben. Umgekehrt entwickelten viele Instrumentalpädagogen in den Kooperationsprogrammen eine Klassenführungskompetenz. Die Entscheidung des DIGV, auch Schwerpunkte aus dem Schulfach Musik für eine Zertifizierung einzufordern, erwies sich aus Sicht der Instrumentalpädagogen daher als richtig.
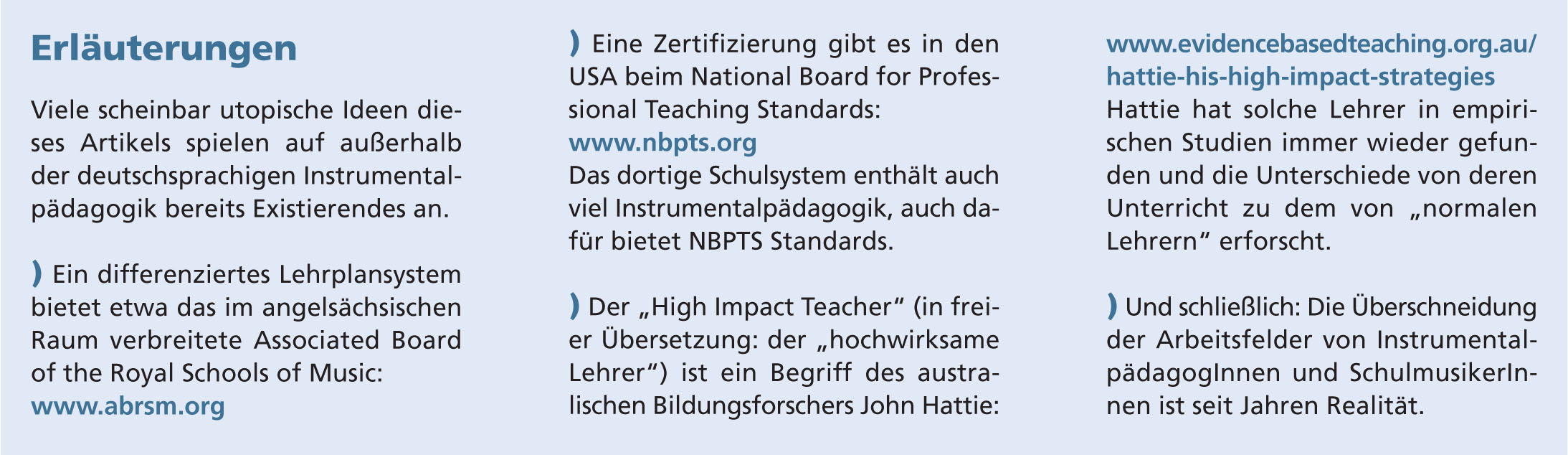
War es früher besser?
Inzwischen hat die Instrumentalpädagogik ein ganz anderes gesellschaftliches Gewicht als noch zu Beginn meiner Berufstätigkeit. Zur Professionalisierung vieler Lehrkräfte kam dann auch die politische Einsicht über die Wichtigkeit des Fachs für die Persönlichkeitsentwicklung. Nach ersten Ansätzen im 20. Jahrhundert hat eine aufsehenerregende Studie dann bewiesen, wie viel an „Metakompetenz“ (ebenfalls ein Schlüsselwort der Bildungsdiskussion zu Beginn des 21. Jahrhunderts) von versierten Instrumentallehrkräften vermittelt werden kann. Die Studie dokumentierte und beschrieb erstmals die besonderen Kompetenzen der Instrumental- und Gesangspädagogen in der Übedikaktik, und gerade dieser Aspekt wurde dann auch zu einer der wichtigsten Zertifizierungsgrundlagen des DIGV.
Insgesamt gibt es heute eine große Anzahl an Instrumentallehrkräften, die vergleichbar viel verdienen wie die Lehrkräfte im Regelschulsystem. Viele arbeiten auch direkt in den Schulen, etwa als BläserklassenlehrerInnen oder MusiklehrerInnen mit Instrumentalbefähigung, ganz ähnlich wie das vorher in den USA schon der Fall war. Jedoch ist der Berufseinstieg nun schwieriger geworden. Honorarverträge und geringfügige Beschäftigungen gibt es kaum noch und viele Anstellungen sind ohne abgeschlossenes Zertifikat gar nicht mehr zu bekommen.
Um die wenigen kleineren Stellen entbrennt immer wieder ein heftiger Kampf, denn nur hier kann man sich die Berufserfahrung aneignen, die für die Zertifizierung des DIGV nötig ist. Es kam zu Beginn der Entwicklung auch gar nicht so selten zu betriebsbedingten Kündigungen, wenn einzelne Musikschullehrkräfte in den allgemein bildenden Schulen nicht mehr zugelassen wurden, weil sie zum Beispiel obligatorische Fortbildungen nicht erfolgreich abschließen konnten. Dadurch wurden viele InstrumentalpädagogInnen gezwungen, sich selbstständig zu machen.
Insbesondere von solchen Lehrkräften, die mit dem sich verändernden System nicht zurechtkamen, kam viel Kritik an den Entwicklungen. Bei den Bläserklassenlehrern etwa, die durch viele Austauschtreffen und Vorlagen aus den USA schnell sehr differenzierte Lehrpläne und Standards entwickelten, war die Rede von „Stadtpfeifergilden“, die sich nun breit machen würden.
Die neuen Lehrpläne wurden von manchen Traditionalisten als kunstfeindlich und als Kreativitätsbremse beschrieben. Allerdings fand ich schon damals, dass niemand je den Beweis angetreten hat, dass ein lehrplanferner Unterricht vorher bessere Lernergebnisse, kreativere Musik oder zufriedenere Schüler erzeugt hätte. Spätestens als sich einige Jahre später das Laienmusizieren exponentiell auf sein heutiges Niveau entwickelte, war auch diese Diskussion beendet. Die vielen Orchester, Chöre und Bands brauchten einfach eine wirklich gut strukturierte Ausbildung in Schule und Musikschule, um ihr heutiges Niveau zu erreichen.
Vom Beruf zur Profession
Insgesamt ist die Instrumentalpädagogik heute dort angekommen, wohin sich auch andere Berufsgruppen auf den Weg gemacht haben. Sie hat einen hohen inneren Organisationsgrad und eigene Verhaltensregeln entwickelt. Inzwischen sind es die InstrumentalpädagogInnen selbst, die Standards des Fachs diskutieren. Ihr Verband DIGV tritt sehr selbstbewusst auch gegenüber dem Trägerverband VdM oder den Musikhochschulen auf und vertritt instrumental- und gesangspädagogische Interessen in politischen Gremien.
Der Berufsstand „Instrumentallehrer/in“ hat heute ein enorm hohes Ansehen bei Eltern und Kindern, die Attraktivität des Berufs auch für hochqualifizierte Lehrkräfte hat deutlich zugenommen. Diese Entwicklung gab es nicht nur in meinem Arbeitsbereich, auch andere machten sich auf diesen Weg zur „Profession“: Ich denke zum Beispiel an die Emanzipation der Pflegewissenschaft vom Fach Medizin und die damit verbundene Aufwertung dieser Berufsgruppe.
Interessant ist auch, dass der Untergang des Abendlandes nicht eingetreten ist, den viele zu Beginn der digitalen Revolution vorausgesagt haben. Wir haben heute wie vor dreißig Jahren dieselbe Nachfrage nach Instrumental- und Gesangsunterricht. Digitale Musikproduktion, der Einsatz von Medien im Unterricht, die professionelle Auseinandersetzung mit freien Lernplattformen und mit den immer weiter ausufernden Foren und Netzwerken der Amateure (früher „Dilettanten“ genannt), alles das gibt es. Jedoch hat sich die grundlegende Form des Musiklernens kaum verändert und die beliebtesten Instrumente sind immer noch mehr oder weniger dieselben. Nur die Lernausbeute ist viel größer und – wie Forschung zeigen konnte – ebenso die Zufriedenheit bei LehrerInnen und SchülerInnen.
Aber es gibt auch subkulturelle Gegenströmungen, die das lehrplanfreie, vollständig selbstbestimmte Lernen wieder betonen. Die Renaissance des Autodidakten als „Digital Learner“ oder die Musik des „Re-Punk“ sind da Beispiele. Vermutlich braucht eine Gesellschaft einfach beides: eine Art Ursuppe, aus der neue Gedanken und Strömungen entstehen, und ein hochstrukturiertes Bildungssystem, wie es mit der neuen Instrumentalpädagogik entstanden ist.

