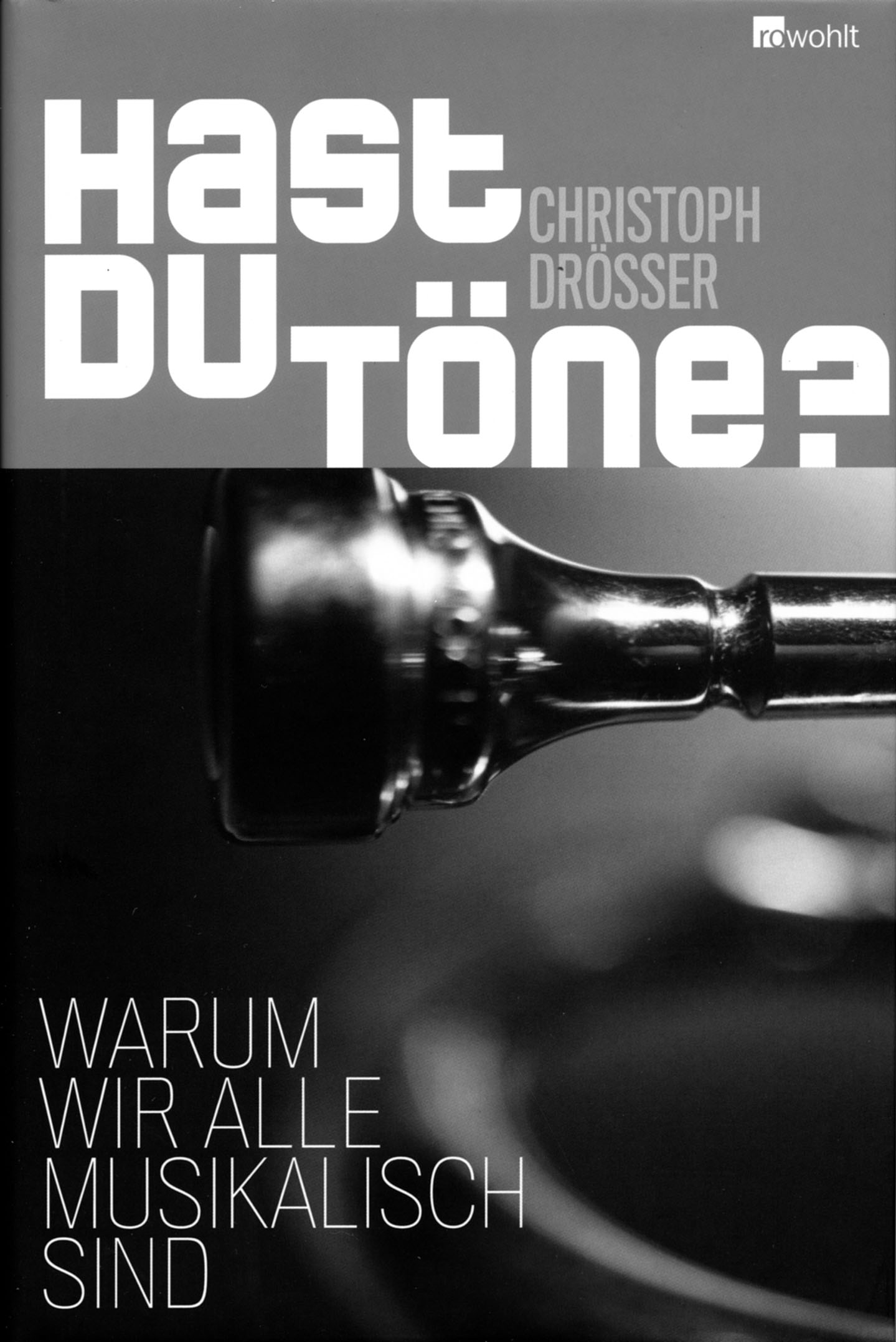Drösser, Christoph
Hast du Töne?
Warum wir alle musikalisch sind
Sonntagabends, wenn aus dem Fernseher der musikalische Abspann zum Tatort tönt, erhebt sich der Hund des Rezensenten und schaut erwartungsvoll in Richtung Sofa. Es ist Zeit für den Abendspaziergang. Das gleiche findet übrigens auch statt bei Tatort-Wiederholungen zu Zeiten, zu denen das Gassi-Gehen gar nicht zur Debatte steht. Ist der Hund des Rezensenten musikalisch? Ist hingegen die kleine Klavierschülerin, die auch nach einem Jahr Unterricht bei der Frage nach „höher“ oder „tiefer“ im Verhältnis zweier Nachbartöne immer noch fragend schaut, unmusikalisch?
Hilfe bei der Beantwortung solcher Fragen gibt dieses ungeheuer faktenreiche Buch, das sich mit „Musikalität“ populärwissenschaftlich, grundlagenorientiert befasst, auf neueste Ergebnisse der Hirnforschung zurückgreift und mit seiner an zahllosen Fakten belegten These, dass wir eine grundsätzlich angeborene Musikalität besitzen, „eine Lanze brechen [will] für die musikalischen Laien und Amateure, die in Chören singen, in Bands spielen oder in Laienorchestern“.
Christoph Drösser ist Mathematiker und Philosoph, arbeitet als Wissenschaftsredakteur bei der Zeit, ist bekennender und kenntnisreicher Pop-Rezipient, -Gitarrist und -Sänger. Seine Affinität zur Klassik ist anscheinend weniger ausgeprägt. Hätte er sonst Robert Weisbergs „Ergebnis“, dass Mozart „sein erstes Meisterwerk mit 21 Jahren komponierte“ (KV 271), so leichtfertig bestätigt und frühere Werke Mozart als „Kuriositäten“ bezeichnet, die „kaum öffentlich aufgeführt“ werden? Auch manche Äußerung zur Neuen Musik („schräge Experimente der Zwölftöner“) blendet den Hörer aus, der sich einem autonomen Musikwerk reflektierend nähert, Musik verstehend hört, nicht – wie intellektuell ausgerichtet auch immer – konsumiert. In manchen seiner Bewertungen scheint Drösser zu sehr ausgerichtet auf die Art von Basismusikalität des nicht musikalisch ausgebildeten Musikhörers, welcher sich sein Buch in beeindruckender Weise widmet und es zu einem (zumindest vorläufigen) Kompendium zum Thema „Musikalität“ macht.
Wenn wir alle musikalisch sind, und zwar von Geburt an, wozu sind wir es? Musik, musikalische Äußerungen auch rudimentärster Art, die Aufnahmebereitschaft dafür verschafft uns einen evolutionären Vorteil. Darwins Satz von der Musik als Mittel, „das andere Geschlecht zu bezaubern“, gilt heute noch, sie ist nach wie vor Balzritual, auch wenn nicht mehr unter dem urzeitlichen Zwang, möglichst viele Nachkommen zu zeugen. Arterhaltend wirkt Musik auch in Kriegsgesängen mittels mutmachender Endorphin-Ausschüttung. Die „friedliche“ Wirkung von Musik schränkt Drösser nicht nur in diesem Zusammenhang ein, auch bezüglich der gern propagierten Transferwirkungen von Musik und Musizieren hat er einen durchaus kritischen Standpunkt.
Über die Tatsache, dass das Ohr uns die Omnipräsenz unserer akustischen Umwelt beschert, gelangt Drösser zu einer Darstellung des Hörsinns, die uns eindringlich macht, dass es der „feinste aller Sinne“ ist. Die Wunder des Schalls, das Ohr und seine Technik und deren Verdrahtung im Gehirn werden ebenso präzise wie kurzweilig verständverständlich gemacht. Musikalische Grundlagen (Skalen, Dreiklänge) sind Thema, wobei die Skalenphysik trotz allen Strebens nach Verständlichkeit für musikalische „Dyskalkulanten“ ein Problem bleiben mag.
Ausführlich nimmt sich das Buch des weiten Bereichs allgemeiner menschlicher Musikalität an, mit zahllosen Nachweisen und Beschreibungen von Testarten und Testreihen – hier scheinen angloamerikanische Forscher führend zu sein, ausgenommen der immer wieder zitierte Eckart Altenmüller, „Deutschlands profiliertester Musikforscher“. Gedankenreich geht es ums Singen und seine Probleme, um den „Soundtrack des Lebens“, um den „universellen Chill“ im Kapitel „Feel – Musik und Gefühl“, um Musik und Gesundheit im Kapitel „Doctor, Doctor…“, das sich mit Autismus oder dem Williams-Syndrom beschäftigt. Übrigens, es gibt auch unmusikalische Menschen: „Amusie“ nennt man diesen Zustand oder auch „tontaub“. Man kann sogar testen, ob man „tone deaf“ ist: Auf einer Internetseite sind allerlei Tonbeispiele, aber auch Hörtests und weiterführende Links abrufbar.
Für alle, die des Notenlesens nicht kundig sind, hat Christoph Drösser eine praktikable Ersatznotenschrift erfunden. Register, Literaturverzeichnis und Lesebändchen komplettieren den Band, der nicht nur dem basismusikalischen Leser, sondern auch dem musikalisch ausgebildeten eine Fülle von Informationen in geistreicher Zusammenschau bietet.
Günter Matysiak