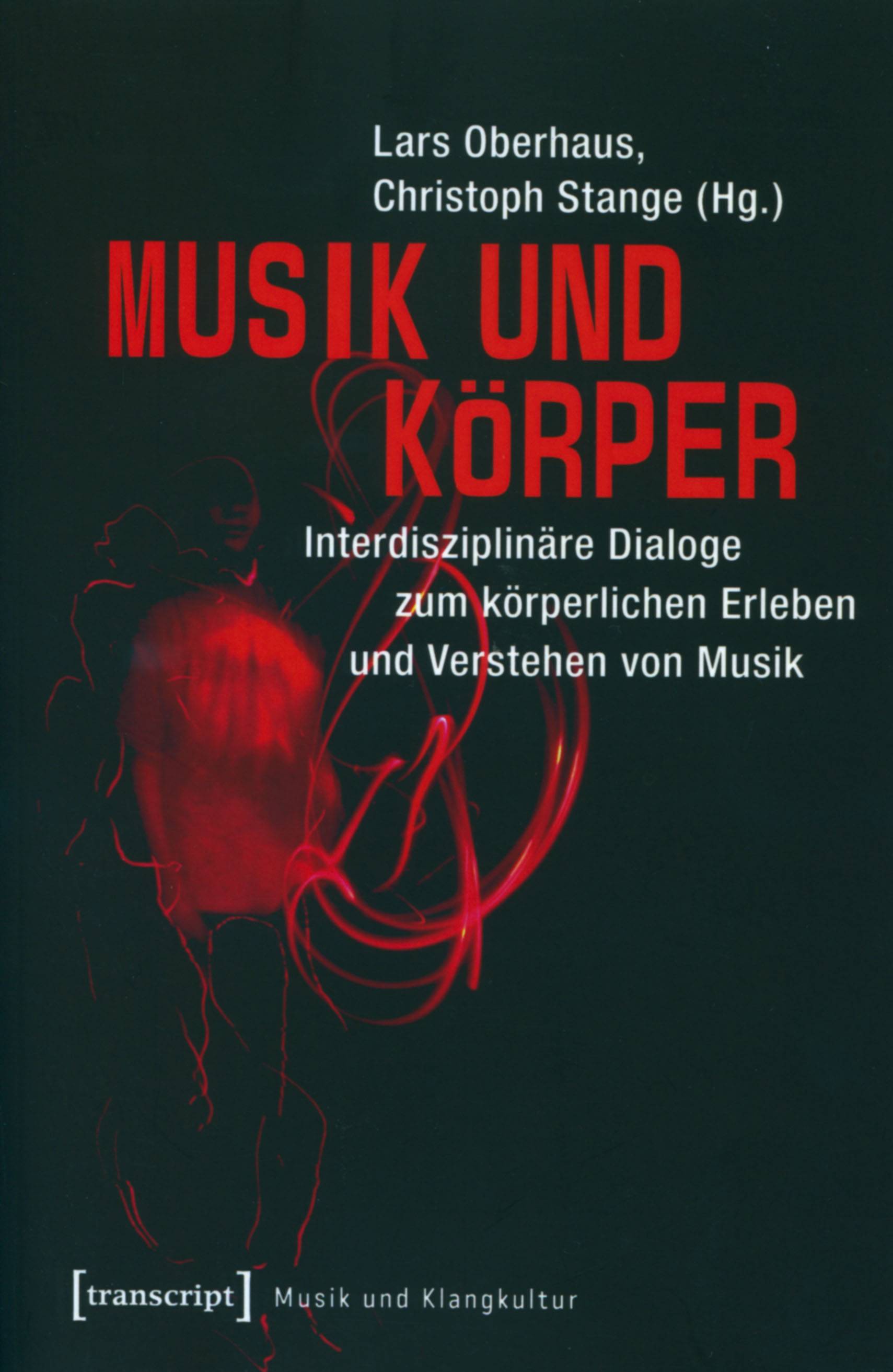Oberhaus, Lars / Christoph Stange (Hg.)
Musik und Körper
Interdisziplinäre Dialoge zum körperlichen Erleben und Verstehen von Musik
Nach langen Jahren der wissenschaftlichen Abstinenz ist die Frage nach dem Verhältnis von Musik und Körper wieder verstärkt in den Fokus getreten. Das zeigt sich an einer Vielzahl von Kongressen und Ringvorlesungen, die zu diesem Thema in jüngerer Zeit stattgefunden haben, sowie an einer zunehmenden Zahl einschlägiger Publikationen. Allerdings wäre es eine Übertreibung, von Konjunktur oder Mode zu reden, denn rein quantitativ ist das Thema Körper, wie die Herausgeber des vorliegenden Bandes zu Recht betonen, im musikbezogenen Schrifttum noch immer ein eher randständiges Phänomen.
Dass man vielleicht doch von einer Wende sprechen kann, hat mit den gewaltigen Entwicklungen in jenen Wissenschaften zu tun, auf die Musikwissenschaft und Musikpädagogik zwangsläufig rekurrieren müssen, sobald sie den Körper thematisieren. Hier sind insbesondere die Entwicklungen in den neueren Kognitionswissenschaften zu nennen, aber natürlich auch Erkenntnisse aus der Neurobiologie.
Die vorliegende Textsammlung ist aus einer interdisziplinären Tagung hervorgegangen, die von Lars Oberhaus und Christoph Stange unter dem Titel Musik erleben und verstehen mit dem Körper initiiert wurde und im März 2016 in Hanse-Wissenschaftskolleg Delmenhorst stattfand. Der Band umfasst Beiträge aus den Bereichen Musikpädagogik, Musikwissenschaft, allgemeine Pädagogik, Musikpsychologie und Tanzwissenschaften nicht jedoch, was bei diesem Thema immerhin auffallend ist, aus der Musikphysiologie. Und auch der Bereich der musikalischen Performanzforschung ist, mit Ausnahme vielleicht des Beitrags von Julia von Hasselbach (der jedoch einen stark instrumentalpädagogischen Fokus hat) nicht vertreten.
Dass sowohl die Tagung selbst als auch die aus ihr hervorgegangenen Texte interdisziplinär ausgelegt sind, ist eng mit dem Gegenstand verbunden. Davon legen nicht nur die unterschiedlichen Disziplinen, denen die AutorInnen angehören, ein beredtes Zeugnis ab, sondern vor allem auch die Texte selbst. Ein Blick in die Literaturverzeichnisse zeigt, dass viele Beiträge sehr bewusst den geschützten Rahmen ihres Fachs verlassen und nach Bezugspunkten in der Philosophie, den Kognitionswissenschaften und den Forschungen zum Thema Embodiment Ausschau halten.
Als häufig gewählte Referenzpunkte fungieren hier zum einen die Kognitionswissenschaften, innerhalb derer es seit längerer Zeit Tendenzen gibt, den Körper nicht mehr nur als Gegenstand der Kognition zu begreifen, sondern als ein im weitesten Sinne intelligibles Phänomen, das beim Zustandekommen von Kognition eine nicht wegzudenkende Rolle spielt. Allerdings wird eine vergleichende Lektüre der unterschiedlichen Texte relativ schnell bemerken, dass auch unter diesem Paradigma recht unterschiedliche Vorstellungen darüber bestehen, wie diese Rolle im Einzelnen aussieht.
Während die Beiträge von Jin Hyuan Kim und Lars Oberhaus davon ausgehen, dass Kognition grundsätzlich als embodied oder situated cognition verstanden werden muss, so argumentiert Wilfried Gruhn aus der Perspektive des lerntheoretischen Ansatzes von Hans Aebli, der im Anschluss an Piaget zwar ebenfalls davon ausging, dass das Denken eine Funktion des Tuns ist, es aber letztlich doch als Ziel von Kognition bestimmte, die Struktur eines erworbenen, d. h. gelernten Handlungsablaufs zu sichern. Das ist weniger radikal als der unter Rückgriff auf Humberto Maturana und Francisco Varela unternommene Definitionsversuch von Lars Oberhaus, der Kognition als eine verkörperlichte Interaktion eines Individuums mit seiner Umwelt kennzeichnet, die ihren Platz nicht ausschließlich im Gehirn hat.
Als ein anderer, ebenfalls häufig gewählter Bezugspunkt fungiert die Phänomenologie des Leibes von Maurice Merleau-Ponty sowie die neueren phänomenologischen Ansätze von Bernhard Waldenfels. Auch hier lassen die Beiträge durchaus unterschiedliche Lesarten erkennen, z. B. hinsichtlich der für Waldenfels so wichtigen Dimension der Fremdheit des eigenen Körpers bzw. der Gleichzeitigkeit von Körperbezug und -entzug. Hier kommen Frauke Heß, Christoph Stange und Wolfgang Rüdiger zu durchaus unterschiedlichen Interpretationen, die man gerne weiter verfolgen würde.
Genau in diesem sich hinter den einzelnen Beiträgen eröffnenden Diskurs liegt die Stärke des vorliegenden Bandes. Die Texte, obschon unabhängig voneinander entstanden, offenbaren ein hohes Maß an gemeinsamen Zugängen, wodurch sie sich bisweilen gegenseitig zu kommentieren scheinen, was die Lektüre zu einem ungemein fesselnden Unterfangen werden lässt. So ließe sich die von Frauke Heß mitgeteilte Frage einer Tänzerin, wieso die Musikpädagogik davon ausgehe, dass Schülerinnen und Schüler über ein derartig ausdifferenziertes Bewegungsrepertoire verfügen, dass Bewegung und Tanz automatisch in den Dienst präsentischen Musikerlebens gestellt werden können, direkt mit dem Beitrag von Peter Röbke konfrontieren, der im Anschluss an Roland Barthes die Frage stellt, ob sich im Singen eines Laien nicht der Leib in all seiner unverfügbaren und unkontrollierbaren Fülle ausspricht, während im Gesang eines Profis der Zugewinn in der technischen Umsetzung musikalischer Vorstellungen [
] zugleich ein Minus an persönlichem Sinn und leiblicher Präsenz beinhalten kann.
Wobei freilich zu fragen wäre, ob für die Arbeit an einer derart rückhaltlosen art brut die Institutionen Schule und Musikschule wirklich die geeigneten Orte sind
Aber genau zu derartigen Fragen animiert der Band: Er dokumentiert nicht nur eine Diskussion, sondern regt einen zukünftigen Austausch an. Es bleibt zu wünschen, dass das in ihm liegende diskursive Potenzial von seinen hoffentlich zahlreichen Leserinnen und Lesern aufgegriffen und weitergetrieben wird.
Wolfgang Lessing